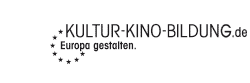Arbeitszeugnis Techno
Premiere von „Denk ich an Deutschland in der Nacht“ im Cinenova – Foyer 05/17
Donnerstag, 4. Mai: Schon vor dem Cinenova bildet sich eine Menschenmenge, die halb nach Kinogängern, halb nach Clubbesuchern aussieht. Es herrscht eine lockere Wochenendstimmung, dabei ist Donnerstagabend. „Hoffnungslos überbucht“ sei die Premiere, hört man vom Filmverleih Rapid Eye Movies. Es geht um Romuald Karmakars „Denk ich an Deutschland in der Nacht“. Der Dokumentarfilm zeigt einige Urgesteine der elektronischen Tanzmusikszene in Deutschland. Für Karmakar ist es bereits der vierte Film über die Technoszene: „Ich habe die Berliner Szene bei den Dreharbeiten zu ‚Warheads‘ kennengelernt, einem Film über Söldner.“ Der ist zwischen 1989 und 1992 enstanden, und irgendwann in dieser Zeit muss es gewesen sein, dass er Clubs wie den Tresor, das WMF oder den „Eimer“ besuchte. „Ich habe damals auch bemerkt, dass die Loveparade schon am Freitag beginnt, aber mit kleinen Gruppen tanzender Menschen auf der Straße. Das passte überhaupt nicht zu dem visuellen Bild, das ich aus den Medien von der Loveparade kannte.“

Auch sein neuester Film findet neue visuelle Entsprechungen für Altbekanntes. Der Film lässt einige Protagonisten zu Wort kommen, die seit Mitte der 80er Jahre die Entwicklung des Techno miterlebten und auch mit prägten. Sie sind in Clubs beim Auflegen zu sehen und erzählen zwischendurch – meist in ihren Studios voller Elektronik – von der Bedeutung der Musik für ihr Leben. Die langen, starren Einstellungen sind ungewöhnlich für einen Musikfilm – aber typisch für Karmakar. „Ich finde, dass man Musik im Film nur auf zwei Arten festhalten kann: entweder mit vielen Kameras oder nur mit einer. Und durch die langen Einstellungen kann man die Arbeitsweise viel besser nachvollziehen, als wenn ich dazwischen immer ins Publikum springe.“ Dieses Ziel unterstützt noch ein technischer Kniff im Schnitt: In einigen langen Szenen im Club passt das Bild nicht zum Ton. Man hört den Kopfhörerkanal, mit dem der DJ den nächsten Track vorhören kann. „Das ist quasi das Logbuch des DJs bei der Arbeit“, erklärt Karmakar die Idee dahinter.

Wie Künstler und Clubbetreiber Ata im Film sagt, gibt es mittlerweile unzählige Varianten und Unterarten von Techno: „Das ist jemandem, der sich nicht damit auskennt, gar nicht mehr zu vermitteln.“ Der Film versucht das auch gar nicht. Dennoch bekommt man allein durch die Auswahl der Clubszenen einen Eindruck der musikalischen Vielfalt. Dreh- und Angelpunkt des Films sind allerdings die Künstler. Große Mainstream-Stars mit Millionen Fans sind dabei nicht zu sehen. Es geht um die Entwicklung der Musik aus dem Underground, um Akteure der ersten Stunde. Und was aus ihnen geworden ist. Während die elektronische Tanzmusik in extrem kapitalisierter Form aus Amerika zurückkehrt (Stichwort EDM), sehnen sich die DJs im Film auch nach Ruhe und Veränderung. Ata will nach Italien ziehen, sein Gemüse selbst anbauen, kochen. Der Clubbetreiber (Robert Johnson in Offenbach) und Restaurantbetreiber hat seine Vinylsammlung verkauft und fühlt sich gut damit, wie er im Cinenova erzählt. Eine kleine Hintertür hat er sich aber einbauen lassen: „Der musste unterschreiben, dass sie am Stück bleibt. Und ich kann sie jederzeit besuchen.“ Statt schweren Kisten legt er jetzt mit USB-Stick auf. Das wird bei einem Popstar wie David Guetta abschätzig belächelt. Doch einem Ata nimmt man ab, dass die Musik noch immer sein Leben bestimmt – auch seine 20 Jahre alten „Schätze“, selbst in digitaler Form.
Zurückblicken ist bei allen Protagonisten angesagt: „Ich hätte so einen Film gerne über die 80er Jahre gehabt“, sagt Ata. Den wird er zwar nicht mehr bekommen, aber für die Szene hat auch dieser Film einen ganz besonderen Wert: „Das ist die Archivierung der Jetztzeit.“
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Als unabhängiges und kostenloses Medium sind wir auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell mit einem freiwilligen Betrag unterstützen möchten, dann erfahren Sie über den nebenstehenden Button mehr.

 Mit Trauer umgehen
Mit Trauer umgehen
„Poison – Eine Liebesgeschichte“ im Odeon – Foyer 02/25
 Wärme, Nähe, Authentizität
Wärme, Nähe, Authentizität
Noah Derksen in den Hängenden Gärten von Ehrenfeld – Musik 02/25
 Klavier statt Karneval
Klavier statt Karneval
Ein Februar mit guter Musik – Unterhaltungsmusik 02/25
 Bittersüße Dystopie
Bittersüße Dystopie
„Ein schöner Ort“ in der Aula der KHM – Foyer 01/25
 Zeit-Fragen
Zeit-Fragen
Symposium der dokumentarfilminitiative im Filmhaus – Foyer 01/25
 Stark durch Solidarität
Stark durch Solidarität
„Billige Hände“ im Filmhaus – Foyer 12/24
 Nicht alle sind supersympathisch
Nicht alle sind supersympathisch
(Kinder-)Geburtstags- und Weihnachtsfeiern on Stage – Unterhaltungsmusik 12/24
 Nach Leerstellen suchen
Nach Leerstellen suchen
„Riefenstahl“ im Weisshauskino – Foyer 11/24
 Noise, Rap und Migration
Noise, Rap und Migration
Zwischen Bühne und Buchdeckel – Unterhaltungsmusik 11/24
 Kunst des Nicht-Wegschneidens
Kunst des Nicht-Wegschneidens
„Anna Zeit Land“ im Filmforum – Foyer 10/24
 Restitution von Kolonialraubkunst
Restitution von Kolonialraubkunst
„Dahomey“ und „The Story of Ne Kuko“ im Filmforum – Foyer 10/24
 von ch-unterhaltungsmusik-678.jpg) Aggressive Dringlichkeit
Aggressive Dringlichkeit
Internationale Acts von Rock über Hip Hop bis Avantgarde – Unterhaltungsmusik 10/24
Zermürbte Gesellschaft
choices preview zu „Critical Zone“ im Odeon – Foyer 11/24
„Mir wurden die Risiken des Hebammenberufs bewusst“
Katja Baumgarten über ihren Film „Gretas Geburt“ – Foyer 11/24
Liebe und Macht
choices preview zu „Power of Love“ in der Filmpalette – Foyer 10/24
Disziplin, Drill und Durchlässigkeit
„Mädchen in Uniform“ im Filmforum – Foyer 08/24
Der Sieg des Glaubens
„Führer und Verführer“ im Odeon mit Regisseur Joachim Lang – Foyer 07/24
Queere Menschen in Polen
„Boylesque“ im Filmhaus – Foyer 07/24