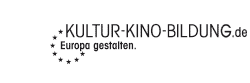Aus den Straßen der Bronx
Arte-Preview an der KHM: „New York – The Music City“ – Foyer 05/15
Mittwoch, 27. Mai: Die Reihe „Arte Preview an der KHM“ könnte auch heißen: Fernsehen auf der Leinwand. Denn ob vor der Ausstrahlung oder nicht, man sieht und hört diese technisch ausgezeichneten Dokumentationen so, wie es zuhause selten möglich ist, eben wie im Kino. Gerade bei einer Musikdoku lohnt sich ein guter Ton, und in „New York – The Music City“ (auf Arte am 6. Juni) geht es manchmal so schnell, dass selbst in einer Kinosituation schwer alles erfasst werden kann. Vielleicht haben die musikerfahrenen Filmemacher Claus Bredenbrock und Pagonis Pagonakis ihr hohes Erzähltempo in New York getankt, oder es war dann doch die Reichhaltigkeit der Metropole, die schließlich noch niemals in 60 Minuten gepasst hat.

Foto: Jan Schliecker
Was sie sich vorgenommen haben, hat es in sich: Einen Einblick in die verschiedenen populären Musikstile zu geben, die in New York zumindest Station gemacht haben oder dort gar entstanden sind, darunter die sehr lebendig gebliebenen Richtungen Hip-Hop, Folk, Salsa und Latin sowie auch Punk, Salsa, New Wave und Bebop. Der historische und ethnische Kontext spielt dabei genauso eine Rolle wie die sozial relevante Geographie innerhalb der Stadt. Viele alte Aufnahmen werden herangezogen, Szeneviertel besucht, Zeitzeugen und Künstler geben Auskunft, Ausschnitte aus Bühnenauftritten und Musikvideos etwa von Blondie oder Jay-Z werden deutsch untertitelt.
Zugang verwehrt
KHM-Professorin und Arte-Redakteurin Sabine Rollberg führte das Publikumsgespräch mit Bredenbrock und Pagonakis. Prominente Musiker vor die Kamera zu holen, beschrieb Bredenbrock als schwieriger denn je: „Inzwischen ist natürlich auch die Reputation des Fernsehens abgesunken, die auch in Deutschland schwer gelitten hat, in den letzten 10 bis 20 Jahren. In den USA ist es erledigt, es hat die Reputation eines Nullmediums.“ Was das zweisprachige Arte sei, wisse und verstehe dort erst recht niemand. So ein europäisches Konzept sei dort „völlig undenkbar“.

Bei Anfragen bei Stars erhalte man in der Regel nicht einmal Absagen, was viel mit der Musikindustrie zu tun habe. Als einen der zugänglichen Protagonisten nannte Pagonakis John Sebastian, der etwas außerhalb Woodstocks lebe und einfach auf die E-Mail geantwortet habe. In New York seien die zwei Regisseure durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen, bis sie am letzten Drehtag zufällig bei einer Hip-Hop Peace Demonstration, der Kinder an die friedlicheren Ursprünge des Rap erinnern sollte, viele Hip-Hopper der ersten Stunde auf der Straße zusammen angetroffen hätten, die sie hintereinander durch interviewten. „So läuft das. Man muss wirklich vor Ort sein.“ Vom Exposé, auf dessen Basis das Projekt genehmigt wurde, weiche das Endresultat an vielen Stellen ab.
Die Mieten immer höher
Heraus kam natürlich auch ein New-York-Porträt, das etwas von den gesellschaftlichen und (stadt-)politischen Veränderungen über die musikrelevanten Jahrzehnte in Bildern und Zeitzeugenberichten festhält und an der Frage der Auswirkungen von Gentrifizierung auf die Kultur nicht vorbeikommt, wenn in den ehemaligen Szenevierteln die Mieten so hoch geworden sind, dass Musikclubs und Künstler immer weiter in Richtung Stadtrand ziehen müssen. Eine Lösung kennt im Film niemand.
Bredenbrock bemerkte das Problem auch beim Dreh: „Ich habe bei Bekannten im Greenwich Village umsonst wohnen dürfen, nebenan hat die Witwe von Steve Jobs ein zweistöckiges Häuschen gekauft, das 16 Millionen Dollar gekostet hat. Da werden Preise aufgerufen, die zwangsläufig zur Folge haben, dass es ganz normalen Menschen unmöglich wird, im Zentrum dieser Stadt zu leben.“ Man habe auch etwa um den Times Square jetzt „Disneyland-Situationen“. „Das sagen die Leute, die dort wohnen. Mich hat das auch nicht mehr so interessiert wie früher. Ich war da lieber in Detroit.“ Dort drehten die zwei den Film „Detroit, Michigan – Motor City Music“, ebenfalls für ihre Reihe musikalischer Stadtporträts, zu der in den vergagenen Jahren auch noch „Memphis, Tennessee – Eine Stadt verändert die Welt“ und „San Francisco – Flower and Power“ gehörten.

Foto: Schliecker
Elend auf offener Straße
Claus Bredenbrock arbeitet seit 43 Jahren als freier Journalist und Autor und hatte ein langes zwiespältiges Verhältnis zu New York. Über die Bowery, eine Straße, von der im Zusammenhang mit der Geschichte des Hip-Hop historische Aufnahmen sozialer Verwahrlosung gezeigt wurden, sagte er:
„Ich bin selbst 1971 oder 1972 zu Ostern das erste Mal über diese große Straße gefahren und war entsetzt. Sie lag voll mit volltrunkenen, zugedröhnten (meist) Männern. Die Außentemperatur Ostern war vielleicht 4 oder 5 Grad, so leichter Schneeregen. Und es war ein so brutaler Anblick, dass ich und meine damalige Freundin beschlossen haben, die Stadt jetzt zu verlassen. Ich hatte, aus dem wohlbehüteten Europa kommend, ein solches Elend, ein so jammervolles, trauriges Abbild menschlicher Niedergeschlagenheit noch nie gesehen, auch in London nicht. Und ich wollte es auch nicht mehr weiter sehen. Und deshalb muss man, wenn man jetzt auf den Song ‚The Message‘ [von Grandmaster Flash] zu sprechen kommt, vom Ende der 70er Jahre, dann muss man schon auch diese Bilder nehmen. Das mit Bildern von heute zu machen, ginge nicht.“
Der Strick wird enger
Die naheliegende Annahme, dass es sich um bekannte amerikanische Archivaufnahmen handelt, ist falsch. Als Quelle historischer Aufnahmen nannte Bredenbrock das WDR-Archiv, für dessen Pflege sich zugleich auch Rollberg stark machte. Viel verwendet habe man Material von Gerd Ruge, dem ehemaligen Amerika- und Washingtonkorrespondenten. „Das Archiv der ARD hat sich in großen Containern nach Köln bewegt, relativ spät, in den letzten Jahren eben erst“, so Bredenbrock. „Da befinden sich großartige Reportagen von so großartigen Kollegen wie Herrn Ruge und Dieter Gütt, ohne die solche Filme heute gar nicht zu machen wären. Die haben so präzise und sauber gearbeitet, und vor allem haben sie mit Film gearbeitet, also nicht mit einem Videoformat, sodass diese Aufnahmen, wenn sie gut konserviert wurden, sehr gut zu verwenden sind. Das Beta-Material, das vor allem in den 80er Jahren entstanden ist, das kann man komplett vergessen.“
Pagonakis ergänzte: „Es ist so frappierend, wenn man sieht, wie vor 30 oder 40 Jahren gearbeitet wurde und wie heute gearbeitet wird. Es sind so tolle Filme, und man sieht, dass sie Zeit hatten, Zeit, sich durch die Stadt zu bewegen, Zeit, sich mit einer Geschichte zu beschäftigen, Zeit, Leute vorher zu kontaktieren und Zeit für Motivbesichtigungen. Und das macht diese Filme bis heute wertvoll, während ich die These wage, dass sehr viele aktuell gedrehte Reportagen aus den 90ern, aus den 2000ern so ein schnelles Verfallsdatum haben, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand darauf zurückgreifen wird.“

Rechte, Honorare und Gebühren
Der eigene Film, so Bredenbrock, habe innerhalb von 10 Tagen (was das Publikum erstaunte) in New York für insgesamt 81.000 Euro entstehen müssen, „und zwar ohne Vorrecherche-Reise. Also was wir da organisiert hatten, hatten wir per Internet und Telefon organisiert. (…) Bei uns ist in den Honoraren nicht einmal mehr ein Recherche-Honorar, nicht einmal mehr das. Deswegen kann ich auch im Nachhinein nur sagen, es war mutig, ohne Verabredung mit einem maßgeblichen Hip-Hop-Vertreter da einfach hinzufahren. Eigentlich sind wir an einem Punkt angekommen, wo das zu diesen Etats nicht mehr machbar ist.“ Daher habe er – Pagonakis sah das bereits etwas optimistischer – keine rechte Lust auf einen angedachten Seattle-Film oder europabezogene Fortsetzungen. „Ich habe im Augenblick erst einmal von diesen Musikrechteverhandlungen und diesem Hin und Her und diesem Vor und Zurück und diesem Wichtigtun und so die Nase voll.“ Er glaube im Moment nicht an Veränderungen bei den Sendern, „denn es wartet ja der Profi-Fußball.“
Rollberg nahm da auch kein Blatt vor den Mund, obwohl sie „nicht jammern“ wollte. „Die beiden haben total recht. Es ist eine Katastrophe.“ Sie verwies auf die Publikation der AG Dokumentarfilm, laut der 80 Prozent der Dokumentarfilmer nicht mehr von ihrer Arbeit leben könnten.
Glück hat man in Deutschland immerhin mit den Musikrechten, was ja auch in Fernsehfilmen oder Reportagen immer wieder zu merken ist. Bredenbrock: „Alle vier Filme hätten wir in den USA überhaupt nicht machen können, weil jeder einzelne Song, der in dem Film vorkommt, vorher mit den Rechteinhabern abgeklärt werden muss. Wenn wir hier im Film Musik im Hintergrund benutzen und Bilder, die wir selbst gedreht haben, dann entrichten wir eine GEMA-Gebühr, und damit ist der Käse gegessen.“ Die Dokus könnten daher auch in den USA nicht gezeigt werden, außer im Goethe-Institut.
Allen Musikfreunden und an Stadtkultur Interessierten ist das Einschalten wärmstens empfohlen.
„New York – The Music City“ | R: Claus Bredenbrock & Pagonis Pagonakis | Arte
Sa 6.6. 22.40 Uhr, Fr 19.6. 01.30 Uhr | Webseite
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Als unabhängiges und kostenloses Medium sind wir auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell mit einem freiwilligen Betrag unterstützen möchten, dann erfahren Sie über den nebenstehenden Button mehr.

 Reizüberflutung mit Konzept
Reizüberflutung mit Konzept
Symposium der Dokumentarfilminitiative – Festival 01/23
 Kannste dir nicht ausdenken…
Kannste dir nicht ausdenken…
Neue Nachrichten aus einer verrückten Welt – Festival 02/20
 Gegen das Spekulantentum
Gegen das Spekulantentum
„Wem gehört die Stadt – Bürger in Bewegung“ im Odeon – Foyer 12/19
 Das andere Geschlecht
Das andere Geschlecht
LaDOC zeigt Filme über die Vulva zwischen Tabu und Tuning – Reihe 12/19
 Die Angst abschütteln
Die Angst abschütteln
„Der nackte König“ im Filmforum – Foyer 12/19
 Kapitalismus außer Kontrolle
Kapitalismus außer Kontrolle
„System Error!“ im Cinenova – Foyer 11/19
 Stereotypen überwinden lernen
Stereotypen überwinden lernen
„Gender Diversität in Film und Fernsehen“ an der KHM – Foyer 12/18
 Mit lauter und klarer Stimme
Mit lauter und klarer Stimme
Beryl Magoko erhält Großen Kunstpreis der Freunde der KHM – Kunst 11/18
 Zwischen Todesangst und Fäkalien
Zwischen Todesangst und Fäkalien
„RocKabul“ und „The Allins“ bei See The Sound – Festival 09/18
 Alleine um die Welt
Alleine um die Welt
„Egal was kommt“ im Cinenova – Foyer 08/18
 Über Kunst, Medien und das Reich dazwischen
Über Kunst, Medien und das Reich dazwischen
Medienkunst-Nachwuchs beim KHM-Rundgang 2018 – Kunst 07/18
 From Rags to Punk
From Rags to Punk
Musikdoku „Parallel Planes“ beim Frauenfilmfestival – Foyer 05/18
Mit Trauer umgehen
„Poison – Eine Liebesgeschichte“ im Odeon – Foyer 02/25
Bittersüße Dystopie
„Ein schöner Ort“ in der Aula der KHM – Foyer 01/25
Zeit-Fragen
Symposium der dokumentarfilminitiative im Filmhaus – Foyer 01/25
Stark durch Solidarität
„Billige Hände“ im Filmhaus – Foyer 12/24
Zermürbte Gesellschaft
choices preview zu „Critical Zone“ im Odeon – Foyer 11/24
„Mir wurden die Risiken des Hebammenberufs bewusst“
Katja Baumgarten über ihren Film „Gretas Geburt“ – Foyer 11/24
Nach Leerstellen suchen
„Riefenstahl“ im Weisshauskino – Foyer 11/24
Kunst des Nicht-Wegschneidens
„Anna Zeit Land“ im Filmforum – Foyer 10/24
Liebe und Macht
choices preview zu „Power of Love“ in der Filmpalette – Foyer 10/24
Restitution von Kolonialraubkunst
„Dahomey“ und „The Story of Ne Kuko“ im Filmforum – Foyer 10/24
Disziplin, Drill und Durchlässigkeit
„Mädchen in Uniform“ im Filmforum – Foyer 08/24
Der Sieg des Glaubens
„Führer und Verführer“ im Odeon mit Regisseur Joachim Lang – Foyer 07/24
Queere Menschen in Polen
„Boylesque“ im Filmhaus – Foyer 07/24