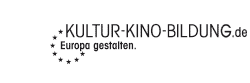Besuch der besten Freundin
Wie ein Bürokrat Tausende Leben rettete – Textwelten 11/16
Jacqueline hatte sich schon in der Schule darüber gewundert, dass die Klassen plötzlich mit so vielen deutschen Flüchtlingskindern angefüllt waren. Das kleine, dünne Mädchen mit den glänzenden schwarzen Haaren gehörte auch zu ihnen, obwohl es schon etliche Jahre mit seiner Familie in Amsterdam lebte. Sie war es auch, die nach der Schule den Kontakt zu Jacqueline suchte und mit dem Fahrrad neben ihr her fuhr. „Sie meinte, wir hätten doch den gleichen Schulweg und könnten Freundinnen werden. „Ich heiße Anne“, sagte sie. Mit ihren 87 Jahren erinnert sich Jacqueline van Maarsen noch genau daran – wie sie betont – dass dieses Mädchen ohne Punkt und Komma auf sie einredete, bis sie beide die Haustüre erreicht hatten. Sie konnte nicht ahnen, dass diese erste Begegnung mit Anne Frank auch ihren Lebensweg auf immer beeinflussen würde. Jacqueline van Maarsen wurde Anne Franks beste Freundin, weil Anne es so wollte, wie sie jetzt bei ihrem Besuch in Köln lachend erzählte.
Das Kölner NS-Dokumentationszentrum hatte den Besuch der Niederländerin und ihres Mannes Ruud Sanders angekündigt und das Publikum füllte nicht alleine den Vortragssaal des EL-DE Hauses. Auch ein zweiter Versammlungsraum war bald komplett belegt und dann standen immer noch gut 200 Besucher auf der Straße. „Ich komme aber heute eigentlich wegen Mathias Middelberg“, erklärte Jacqueline van Maarsen entschuldigend. Middelberg ist der Biograf von Hans Calmeyer, ihm hat Jacqueline van Maarsen zu verdanken, dass sie nicht wie ihre Freundin deportiert wurde. Eine Tatsache, von der sie erst vor zwei Jahren erfahren hat, denn Middelberg rekonstruierte, wie der von den Nazis eingesetzte ‚Rassereferent‘ für die Niederlande ein eigenes bürokratisches Regelwerk erfand, mit dem sich die jüdische Herkunft etlicher Familien umdeuten ließ. 1700 Fälle konnte er nicht in diesem Sinne bearbeiten, was für die Betreffenden einem Todesurteil gleichkam. Heute kennt alle Welt Oskar Schindlers „Liste“, wenige wissen jedoch von Hans Calmeyers „Liste“, die mit 3700 Namen dreimal so lang ist, wie die des Unternehmers Schindler.
„Nach dem Kriege wollte niemand von diesen Dingen etwas hören. Als mir Otto Frank von seinem Plan berichtete, Annes Tagebuch zu veröffentlichen, konnte ich mir nicht vorstellen, dass sich dafür jemand interessieren würde“, erzählt van Maarsen. Auch Calmeyer, der 1972 mit 69 Jahren starb, sprach nur mit wenigen Vertrauten über seine traumatischen Erinnerungen. „Er war der Meinung, dass man ihn bei Bekanntwerden im Nachkriegsdeutschland als Verräter und nicht als Helden bezeichnet hätte“, meint Middelberg. Middelbergs Arbeit zeigt exemplarisch, wie mit der Recherche der historischen Verbrechen auch die Leistungen jener Menschen ans Licht kommen, die unspektakultär ihren Mut im Angesicht der Diktatur bewiesen haben. Jaqueline van Maarsen betrachtet ihren Besuch in Deutschland deshalb auch bewusst als Zeichen gegen die Hetze rechter Populisten.
Jacqueline van Maarsen: Deine beste Freundin Anne Frank | Dt. von Mirjam Pressler | KJB | 208 S. | 12,99 €
Mathias Middelberg: Wer bin ich, dass ich über Leben und Tod entscheide? Hans Calmeyer ‚Rassereferent‘ in den Niederlanden 1941-1945 | Wallstein Verlag | 272 S. | 19,90 €
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Als unabhängiges und kostenloses Medium sind wir auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell mit einem freiwilligen Betrag unterstützen möchten, dann erfahren Sie über den nebenstehenden Button mehr.

 Über Weltschmerz sprechen
Über Weltschmerz sprechen
„Alles, was wir tragen können“ von Helen Docherty – Vorlesung 04/25
 Auch Opfer des Zweiten Weltkrieges
Auch Opfer des Zweiten Weltkrieges
Die „Dritte Welt“ im Zweiten Weltkrieg im NS-DOK
 Verlustschmerz verstehen
Verlustschmerz verstehen
„Als der Wald erwachte“ von Emma Karinsdotter und Martin Widmark – Vorlesung 03/25
 Demokratie braucht Demokraten
Demokratie braucht Demokraten
„AfD verbieten: Probleme gelöst?“ im NS-Dok – Spezial 03/25
 Cool – cooler – Aal
Cool – cooler – Aal
„Egal, sagt Aal“ von Julia Regett – Vorlesung 03/25
 Aus dem belagerten Sarajevo
Aus dem belagerten Sarajevo
„Nachtgäste“ von Nenad Veličković – Literatur 03/25
 Der legendäre Anruf
Der legendäre Anruf
Ismail Kadares Recherche über Stalin und Boris Pasternak – Textwelten 03/25
 Internationales ABC
Internationales ABC
„A wie Biene“ von Ellen Heck – Vorlesung 02/25
 Zwei Freunde
Zwei Freunde
„Am Ende der Welt“ von Anna Desnitskaya – Vorlesung 02/25
 „Afrika ist mehr als Hunger und Krieg“
„Afrika ist mehr als Hunger und Krieg“
Autor und Influencer Stève Hiobi über sein Buch „All about Africa“ – Interview 02/25
 Wem gehört Anne Frank?
Wem gehört Anne Frank?
„Immer wenn ich dieses Lied höre“ von Lola Lafon – Literatur 02/25
 Schrecklich komisch
Schrecklich komisch
Tove Ditlevsens Roman „Vilhelms Zimmer“ – Textwelten 02/25
Erinnerungskultur
Gegen Vergessen und für Empathie – ComicKultur 04/25
Ein wunderbarer Sound
Natalia Ginzburgs Roman „Alle unsere Gestern“ – Textwelten 04/25
„Schon immer für alle offen“
Marie Foulis von der Schreibwerkstatt Köln über den Umzug der Lesereihe Mit anderen Worten – Interview 03/25
Die Geschichte der Frau
Ein Schwung neuer feministischer Comics – ComicKultur 03/25