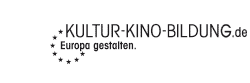Die große Lüge der Asyldebatte
Shumona Sinha präsentiert ihren Roman „Erschlagt die Armen!“ – Textwelten 06/16
Eine Frau, die sagt, was sie denkt, kann in Europa schnell ihren Job verlieren. Die 1973 in Kalkutta geborene und seit 2001 in Paris lebende Shumona Sinha verdiente ihr Geld als Dolmetscherin in einer Agentur der französischen Asylbehörde. Nachdem ihr Roman „Erschlagt die Armen“ 2011 in Frankreich erschienen war, erhielt sie die Kündigung. Zwar ging ein Aufschrei der Empörung durch die Feuilletons, aber an dem Rausschmiss änderte das nichts. Zu nah war die Bengalin den nationalen Tabus gekommen.
Zwölf Stunden am Tag hatte sie in der „Lügenmaschine“ gearbeitet. Wenn sie nach Hause kam, war sie todmüde, aber schlafen konnte sie erst, wenn sie eine Begebenheit des Tages niedergeschrieben hatte. Für Shumona Sinha war das Schreiben eine Überlebensstrategie. Heute kann sie über die Reaktion der Behörde lachen, wie sie jetzt im Institut Français gestand, wohin sie die Buchhandlung Bittner und das Literaturhaus Köln eingeladen hatten. Der Roman – dessen Titel einem Baudelaire-Zitat entnommen ist – besteht aus dem fulminanten Monolog einer Übersetzerin, die verhaftet wurde, nachdem sie einem Asylsuchenden eine Weinflasche über den Kopf gezogen hatte.
Auch wenn Erzählerin und Autorin nicht identisch sind, so decken sich ihre Erfahrungen. Für Sinha ist der überwiegende Teil der Asylsuchenden nicht politisch verfolgt. „Natürlich sind die Menschen aus Syrien oder dem Tschad vom Krieg bedroht“, räumt sie ein. Die Masse der Asylsuchenden treibe jedoch Umweltkatastrophen und die wirtschaftliche Not nach Europa. Und sie bietet einen Ausblick auf die zukünftigen Menschenströme, wenn sie zu bedenken gibt, dass ein Land wie Bangladesch in zehn Jahren möglicherweise gar nicht mehr existieren wird.
Nur politisch Verfolgte besitzen Anspruch auf Asyl, „also müssen die Menschen die Wahrheit verschweigen und eine Geschichte erfinden“. Aus dieser Situation entsteht „die Lügenmaschine, in der alles falsch ist, die Geschichten und die Identitäten“. Ihr Roman enthält bittere wie schreiend komische Szenen. Die Überprüfung der politischen Motive durch die Behörde entpuppt sich als Hirngespinst eines ratlosen europäischen Denkens. Eine Situation, die derzeit von Schweden bis an den Bosporus millionenfach exerziert wird. Die Absurdität dieses rhetorischen Schattenboxens verursacht in Sinha einen tiefen moralischen Ekel. Sie sieht die Selbsterniedrigung der Betroffenen und beobachtet den postkolonialen Rassismus, der im Bewusstsein der Flüchtenden verankert ist, die alle am europäischen Way of Life gesunden wollen. Der Roman spiegelt die Schizophrenie der politischen Situation aber auch in den psychologischen Beobachtungen wieder. So entgehen Sinha auch nicht die Gesten, in denen sich Beamte oder Bittsteller verraten, so dass die Körper von etwas anderem erzählen, als die Worte. Ein Theater, dessen Schmierenpotenzial alle Beteiligten geflissentlich übersehen.
Shumona Sinha: Erschlagt die Armen! | Dt. von Lena Müller | Edition Nautilus | 128 S. | 18 €
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Als unabhängiges und kostenloses Medium sind wir auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell mit einem freiwilligen Betrag unterstützen möchten, dann erfahren Sie über den nebenstehenden Button mehr.

 Über Weltschmerz sprechen
Über Weltschmerz sprechen
„Alles, was wir tragen können“ von Helen Docherty – Vorlesung 04/25
 Verlustschmerz verstehen
Verlustschmerz verstehen
„Als der Wald erwachte“ von Emma Karinsdotter und Martin Widmark – Vorlesung 03/25
 Cool – cooler – Aal
Cool – cooler – Aal
„Egal, sagt Aal“ von Julia Regett – Vorlesung 03/25
 Aus dem belagerten Sarajevo
Aus dem belagerten Sarajevo
„Nachtgäste“ von Nenad Veličković – Literatur 03/25
 Der legendäre Anruf
Der legendäre Anruf
Ismail Kadares Recherche über Stalin und Boris Pasternak – Textwelten 03/25
 „Afrika ist mehr als Hunger und Krieg“
„Afrika ist mehr als Hunger und Krieg“
Autor und Influencer Stève Hiobi über sein Buch „All about Africa“ – Interview 02/25
 Internationales ABC
Internationales ABC
„A wie Biene“ von Ellen Heck – Vorlesung 02/25
 Zwei Freunde
Zwei Freunde
„Am Ende der Welt“ von Anna Desnitskaya – Vorlesung 02/25
 Wem gehört Anne Frank?
Wem gehört Anne Frank?
„Immer wenn ich dieses Lied höre“ von Lola Lafon – Literatur 02/25
 Schrecklich komisch
Schrecklich komisch
Tove Ditlevsens Roman „Vilhelms Zimmer“ – Textwelten 02/25
 Unsichtbare Krankheiten
Unsichtbare Krankheiten
„Gibt es Pflaster für die Seele?“ von Dagmar Geisler – Vorlesung 01/25
 Mit KI aus der Zwangslage
Mit KI aus der Zwangslage
„Täuschend echt“ von Charles Lewinsky – Literatur 01/25
Erinnerungskultur
Gegen Vergessen und für Empathie – ComicKultur 04/25
Ein wunderbarer Sound
Natalia Ginzburgs Roman „Alle unsere Gestern“ – Textwelten 04/25
„Schon immer für alle offen“
Marie Foulis von der Schreibwerkstatt Köln über den Umzug der Lesereihe Mit anderen Worten – Interview 03/25
Die Geschichte der Frau
Ein Schwung neuer feministischer Comics – ComicKultur 03/25