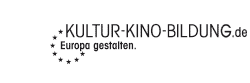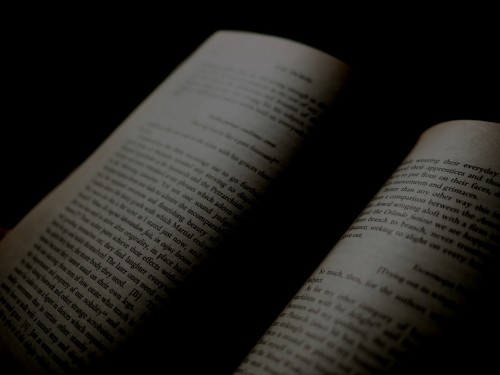
Warum Online-Lesungen die Literatur nicht retten
Kölner Lesereihen und Corona – Literatur 04/20
Zehn Jahre Literaturklub sollte es eigentlich am Montag, 21. April, in der Kölner Wohngemeinschaft heißen, nun begrüßt Veranstalter Adrian Kasnitz das Publikum aus seinem Wohnzimmer auf Facebook. Mit jedem Lesenden wechseln die Zuschauer die Wohnung, ziehen durch eine digitale Wohngemeinschaft, die zwar interessante Einblicke ins heimische Interieur bietet, die gesellige Atmosphäre einer Bar jedoch nicht ersetzen kann. Das Veranstaltungsverbot trifft die Literaturveranstalter in Köln genauso wie überall im deutschsprachigen Raum. Entweder man lässt die Veranstaltung ausfallen oder versucht es im Livestream.
Trotz des durchaus gelungenen Online-Jubiläums ist die aktuelle Situation für Kasnitz „eine Katastrophe“, wie er im Vorfeld des Jubiläums mitteilt. Denn für ihn gilt, was für alle Veranstalter auch ohne Corona gilt: Aufmerksamkeit für gute Literatur schaffen, Publikum gewinnen und ein faires Honorar zahlen. Das alles ist in Coronazeiten kaum bis gar nicht möglich. Zwar könne er Veranstaltungen wie das zehnjährige Jubiläum durchführen – das aber nur, weil das Kulturamt seine Unterstützung vor der Krise zugesagt hat. Geld für neue Veranstaltungen gibt es während der Krise nicht. Das heißt auch: Neue Formate, die sich mit der aktuellen Situation auseinandersetzen, sind nicht oder nur mit Mitteln, die bereits für ein anderes Projekt bewilligt wurden, umsetzbar.

Bild: Screenshot Literaturclub
Immerhin kann Kasnitz den Lesenden des Literaturklubs auf diese Weise ein Honorar zahlen, auch wenn es geringer ausfällt als üblich. Denn mit dem Eintrittsgeld fehlen wichtige Einnahmen. Veranstaltungen, die sich nur durch Eintritte finanzieren, seien gar nicht oder nur ohne Honorar möglich – für Veranstalter und Autor ein unerträglicher Spagat zwischen Aufmerksamkeit und Broterwerb, der besonders schmerzt, wenn man auf die mangelhafte NRW-Soforthilfe für Kunstschaffende blickt. Wie dringend hier nachgebessert werden muss, zeigt der offene Brief von Gerrit Wustmann und 170 weiteren Kulturschaffenden aus NRW, in dem es heißt: „Der NRW-Soforthilfetopf für Kulturschaffende war eine gute Geste, die begrüßt wurde. Doch Fakt ist, dass die Allermeisten nun eine Absage erhalten haben.“ (Link)
Wer eine Lesereihe wie den Literaturklub, Land in Sicht oder die Zwischenmiete in Köln organisiert, richtet sich an das Kölner Publikum. Online-Veranstaltungen könnten daher, so Kasnitz, nur ein Angebot sein. Selbst wenn sie den netten Nebeneffekt mitbringen, im digitalen Raum auch Literaturinteressierte aus anderen Orten zu erreichen. Die direkte Begegnung zwischen Publikum und Autoren könnten Streamings nicht ersetzen. Denn gerade diese Begegnungen zeichnen Lesereihen aus: Sie schaffen Räume des Austauschs, wie es auf der Seite der Unabhängigen Lesereihen (Link), einem Zusammenschluss der freien deutschsprachigen Literaturveranstalter, heißt, zu dem auch der Kölner Literaturklub gehört.
Bei Lesereihen sind das auch immer Begegnungen mit neuem Publikum und gerade das ist im virtuellen Raum und im Speziellen auf Social Media nicht leicht zu adressieren. Erreichen die Veranstaltungen doch zunächst die eigene Crowd und Follower der Lesenden. Um darüber hinauszugehen, tun sich Literaturveranstalter zusammen. Das in der Schweiz beheimatete Viral Festival, das jeden Abend auf Facebook (Link) zu Online-Lesungen einlädt, stellt verschiedene Literaturveranstaltungen und Literaturzeitschriften vor. In Köln laden die Lesereihe „Land in Sicht“ und das Kölner Literaturhaus Autoren ein, in Kurzvideos ihre aktuellen Publikationen vorzustellen. Pro Woche erschienen drei sogenannte Kölner Literaturclips auf YouTube (Link).
Damit reihen sich die Kölner Organisatoren in eine eindrucksvolle Parade von Online-Kultur ein, die auf einmal die Möglichkeit bietet, in das Programm des Deutschen Theaters in Berlin, in die „Kammer 4“, das Online-Angebot der Münchner Kammerspiele, oder auf Kulturama, der internationalen Streaming-Plattform des Goethe Instituts, reinzuklicken. Auch wenn das deutschsprachige Kulturangebot aktuell scheinbar in seiner ganzen Fülle näher an die Rezipienten heranrückt, kann es eben doch die unmittelbare Erfahrung nicht ersetzen und deshalb bleibt nur zu hoffen, dass aus dem „Fernbier“, das es zum Ausklang des Literaturklubs nur digital gab, bald wieder ein gemeinsames Kölsch am Tresen der Wohngemeinschaft wird.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Als unabhängiges und kostenloses Medium sind wir auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell mit einem freiwilligen Betrag unterstützen möchten, dann erfahren Sie über den nebenstehenden Button mehr.

 Unglückliche Ehen
Unglückliche Ehen
„Coast Road“ von Alan Murrin – Literatur 04/25
 Über Weltschmerz sprechen
Über Weltschmerz sprechen
„Alles, was wir tragen können“ von Helen Docherty – Vorlesung 04/25
 Verlustschmerz verstehen
Verlustschmerz verstehen
„Als der Wald erwachte“ von Emma Karinsdotter und Martin Widmark – Vorlesung 03/25
 Cool – cooler – Aal
Cool – cooler – Aal
„Egal, sagt Aal“ von Julia Regett – Vorlesung 03/25
 Aus dem belagerten Sarajevo
Aus dem belagerten Sarajevo
„Nachtgäste“ von Nenad Veličković – Literatur 03/25
 Der legendäre Anruf
Der legendäre Anruf
Ismail Kadares Recherche über Stalin und Boris Pasternak – Textwelten 03/25
 Internationales ABC
Internationales ABC
„A wie Biene“ von Ellen Heck – Vorlesung 02/25
 Zwei Freunde
Zwei Freunde
„Am Ende der Welt“ von Anna Desnitskaya – Vorlesung 02/25
 „Afrika ist mehr als Hunger und Krieg“
„Afrika ist mehr als Hunger und Krieg“
Autor und Influencer Stève Hiobi über sein Buch „All about Africa“ – Interview 02/25
 Wem gehört Anne Frank?
Wem gehört Anne Frank?
„Immer wenn ich dieses Lied höre“ von Lola Lafon – Literatur 02/25
 Schrecklich komisch
Schrecklich komisch
Tove Ditlevsens Roman „Vilhelms Zimmer“ – Textwelten 02/25
 Unsichtbare Krankheiten
Unsichtbare Krankheiten
„Gibt es Pflaster für die Seele?“ von Dagmar Geisler – Vorlesung 01/25
Die Kunst der zärtlichen Geste
„Edith“ von Catharina Valckx – Vorlesung 04/25
Erinnerungskultur
Gegen Vergessen und für Empathie – ComicKultur 04/25
Ein wunderbarer Sound
Natalia Ginzburgs Roman „Alle unsere Gestern“ – Textwelten 04/25
„Schon immer für alle offen“
Marie Foulis von der Schreibwerkstatt Köln über den Umzug der Lesereihe Mit anderen Worten – Interview 03/25
Die Geschichte der Frau
Ein Schwung neuer feministischer Comics – ComicKultur 03/25