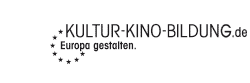Ritt auf dem Pfeil der Zeit
Rüdiger Safranskis Gedanken zur Zeit auf der phil.Cologne – Literatur 06/16
Die „lange Weile“ ist für Rüdiger Safranski das prägende Merkmal der modernen Zeiterfahrung. „Wenn der Ereignisteppich fadenscheinig wird, gibt er den Blick frei auf eine leere Zeit“, erklärt Deutschlands populärster Philosoph. Die Zeit ist aber gar nicht leer, das kommt uns nur so vor, tatsächlich würde es ohne Ereignisse gar keine Zeit geben. Die Empfindung der Leere entsteht dadurch, dass in uns kein Interesse gezündet wird. Anlass für Rüdiger Safranskis Besuch im Klaus-von-Bismarck-Saal des WDR war die Präsentation seines neuen Buchs „Zeit – was sie aus uns macht und was wir aus ihr machen“.
Der 71-Jährige scheint noch ganz im Banne dieser Arbeit zu stehen, immer wieder doziert er voller Faszination über die Phänomene der Vergänglichkeit und schien Christian Schärf, den Moderator der phil.Cologne, für Momente ganz zu vergessen. Der überlässt dem Gelehrten geschickt das Terrain, denn mit Safranskis Eifer sprudeln die Erkenntnisse über das Urphänomen menschlichen Lebens nur so hervor. Safranski ereifert sich über die Tatsache, dass sich in unserer Gegenwart erstmals das Phänomen der „Echtzeit“ realisiert. Wir telefonieren ungehindert mit dem anderen Ende der Welt, während in der gesamten Menschheitsgeschichte jede Nachricht verspätet eintraf. Sandte der spanische König einen Befehl nach Südamerika aus, traf ein Jahr später die Vollzugsmeldung in Madrid ein.
Vieles in Safranskis brillant geschriebener Abhandlung kann man auch bei anderen Autoren nachlesen, aber dann blitzen doch wieder neue Aspekte des prägenden Zeitphänomens auf. Wie sehr etwa die Medien mit den Vorstellungen der Menschen in unterschiedlichen Kulturkreisen spielen, macht er anhand der Flüchtlingskrise deutlich. So werde den Menschen im Nahen Osten vermittelt, dass sie rückständig seien, und diese wünschten sich, an einer Gegenwart teilzunehmen, die sie in Europa verorten. Europäische Touristen suchen hingegen im Orient und in den Ländern Afrikas nach den Spuren der Vergangenheit.
Am Ende der Zeit wartet der Tod. Diese Erkenntnis ist uns gewiss, aber Safranski ergeht sich nicht im Pessimismus der Tatsachen, sondern richtet den Blick auch auf die erfüllte Zeit und den Ewigkeitsgedanken. Interessant auch das „Spiel mit der Zeit“, wie es die Literatur und vor allem der Kriminalroman betreibt. Kultur bietet Reflexion, aber angesichts der Bedrohungen der Zeit, ist sie für Safranski dann doch nur ein „Zeitvertreib“, wie er seinem verblüfften Publikum mit lässiger Geste eröffnet. Ein Zeitvertreib, der jedoch der modernen Tendenz der Verdinglichung begegnet. Vor allem die Wissenschaft begann seit dem 18. Jahrhundert ein neues Menschenbild zu konstruieren, in dem der Mensch als Sache unter anderen Sachen gehandelt wurde. Safranski vermutet hinter dieser Verdinglichung eine psychologische Strategie. Denn Dinge haben keine Zeiterfahrung; indem wir uns verdinglichen, entgehen wir scheinbar der Zeiterfahrung des Alterns, dafür büßen wir jedoch unser Selbstbestimmungsrecht und letztlich unsere Freiheit ein.
Rüdiger Safranski: Zeit – was sie aus uns macht und was wir aus ihr machen | Carl Hanser Verlag | 272 S. | 24,90 €
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Als unabhängiges und kostenloses Medium sind wir auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell mit einem freiwilligen Betrag unterstützen möchten, dann erfahren Sie über den nebenstehenden Button mehr.

 Unglückliche Ehen
Unglückliche Ehen
„Coast Road“ von Alan Murrin – Literatur 04/25
 Über Weltschmerz sprechen
Über Weltschmerz sprechen
„Alles, was wir tragen können“ von Helen Docherty – Vorlesung 04/25
 Verlustschmerz verstehen
Verlustschmerz verstehen
„Als der Wald erwachte“ von Emma Karinsdotter und Martin Widmark – Vorlesung 03/25
 Cool – cooler – Aal
Cool – cooler – Aal
„Egal, sagt Aal“ von Julia Regett – Vorlesung 03/25
 Aus dem belagerten Sarajevo
Aus dem belagerten Sarajevo
„Nachtgäste“ von Nenad Veličković – Literatur 03/25
 Der legendäre Anruf
Der legendäre Anruf
Ismail Kadares Recherche über Stalin und Boris Pasternak – Textwelten 03/25
 Internationales ABC
Internationales ABC
„A wie Biene“ von Ellen Heck – Vorlesung 02/25
 Zwei Freunde
Zwei Freunde
„Am Ende der Welt“ von Anna Desnitskaya – Vorlesung 02/25
 „Afrika ist mehr als Hunger und Krieg“
„Afrika ist mehr als Hunger und Krieg“
Autor und Influencer Stève Hiobi über sein Buch „All about Africa“ – Interview 02/25
 Wem gehört Anne Frank?
Wem gehört Anne Frank?
„Immer wenn ich dieses Lied höre“ von Lola Lafon – Literatur 02/25
 Schrecklich komisch
Schrecklich komisch
Tove Ditlevsens Roman „Vilhelms Zimmer“ – Textwelten 02/25
 Unsichtbare Krankheiten
Unsichtbare Krankheiten
„Gibt es Pflaster für die Seele?“ von Dagmar Geisler – Vorlesung 01/25
Die Kunst der zärtlichen Geste
„Edith“ von Catharina Valckx – Vorlesung 04/25
Erinnerungskultur
Gegen Vergessen und für Empathie – ComicKultur 04/25
Ein wunderbarer Sound
Natalia Ginzburgs Roman „Alle unsere Gestern“ – Textwelten 04/25
„Schon immer für alle offen“
Marie Foulis von der Schreibwerkstatt Köln über den Umzug der Lesereihe Mit anderen Worten – Interview 03/25
Die Geschichte der Frau
Ein Schwung neuer feministischer Comics – ComicKultur 03/25