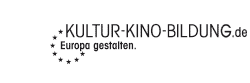Sexueller Missbrauch
Adélaïde Bon mit „Das Mädchen auf dem Eisfeld“ auf der lit.Cologne – Literatur 04/19
Im Rahmen der nunmehr 19. lit.Cologne fand in diesem Jahr etwas Besonderes statt: eine Therapiesitzung in einer Kirche. Der Andrang war groß. Offenbar ist der Bedarf an Therapie groß. Dann betritt die französische Autorin Adélaïde Bon die Bühne und lächelt. Neben ihr sitzen Schauspielerin Nina Kunzendorf und Autorin und Literaturkritikerin Olga Mannheimer, die die Lesung moderiert. Der 1981 geborenen Pariserin geschah als Neunjährige etwas Unsägliches und gleichzeitig Universelles: Sie wurde im Hausflur von einem Fremden sexuell missbraucht. Jahrelang verdeckt sie dieses Ereignis und den daraus resultierenden Hass auf sich selbst. Sie macht weiter, wird Schauspielerin. Denn auf der Bühne kann sie eine andere spielen. Doch die Leere in ihr ist zu einnehmend, die destruktive Energie zu groß. So schreibt Bon: „Sie lächelt. Sie ist lieb. Dabei ist sie eigentlich tot.“
Fortan leidet sie an Angstzuständen und Panikattacken. An Wut und dem Gefühl zu ersticken. Durchlebt Albträume, fügt sich Schmerzen zu, um sich zu spüren. Sie befindet sich einem Kriegszustand, von dem sie nichts weiß. Ständig wird sie in den Körper eines Kindes zurückversetzt. Zudem plagen sie chronische Kieferschmerzen, weil ein Fremder ihr einst seinen Penis in den Mund rammte, als sie ein Kind war. Seitdem leidet Bon an einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), wie sie später feststellt, für die sie zunächst keine Sprache fand.
In ihrem schonungslosen autobiografischen Buch über die fremdbestimmte Gewalterfahrung in ihrer Kindheit mit dem Titel „Das Mädchen auf dem Eisfeld“ (2018 in Frankreich; dt. Übersetzung 2019 bei Hanser) findet sie schließlich sehr wohl Worte. Sogar dichterische: „Ihr ganzer Körper ist eine einzige sich drehende und einstürzende Sandwüste.“ Mehr noch: Sie hat einen Teil von sich abgespalten. Sich selbst entfremdet. Im Unterbewussten. Ein totes Gebiet, das sie bildhaft „Eisfeld“ nennt. Eines, das ständig droht, sich zu entladen. Es ist in der Amygdala abgekapselt, einem Teil des Gehirns, der für das Empfinden von Gefühlen verantwortlich ist, insbesondere von Furcht. Die Amygdala speichert die Erinnerung aber nur indirekt ab, wie Olga Mannheimer dem Publikum erklärt. Somit ist das Problem bei einem Trauma viel größer, ist es doch gleichzeitig die Schwierigkeit, sich an das Geschehene rational zu erinnern und es richtig einzuordnen.
Erst seit den 60er/70er Jahren wird die Posttraumatische Belastungsstörung tatsächlich als Krankheit in Therapien aufgegriffen und behandelt, klärt Mannheimer das ergriffene Publikum auf. Bon selber benutzt für dieses Trauma die Metapher der Medusa. Sie wurde vergewaltigt und aufgrund ihrer anschließenden Hässlichkeit aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, also auch noch bestraft.
Mannheimer verweist auf einen doppelten Verlust: den des Bodens unter den Worten, der damit einhergehe, dass man selbst den Boden unter den Füßen verliert. Die anfangs verstummte Adélaïde Bon hat ihre Sprache und den Boden unter den Füßen wiedergefunden, wenngleich jener manchmal noch wackelt. Die sexuelle Gewalterfahrung in ihrer Kindheit mag einen zerstörerischen Einfluss auf ihr Leben gehabt haben. Andererseits hat sie eine starke Kraft in ihr losgetreten, darüber zu schreiben. Und Bon hat durch den Vorfall etwas gelernt: zum Beispiel dass die ungewollte Penetration in den Mund, wie es bei ihr geschah, sehr wohl eine Vergewaltigung ist und nicht nur unter unsittliche Berührung fällt. Der Täter, der zahlreiche Mädchen missbrauchte, wurde gefasst. Am Ende der ausverkauften Veranstaltung ist es totenstill in der Kulturkirche, bevor schließlich tosender Applaus einsetzt.
Adélaïde Bon: Ein Buch wie eine Therapie | Hanser | 240 S. | 22 €
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Als unabhängiges und kostenloses Medium sind wir auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell mit einem freiwilligen Betrag unterstützen möchten, dann erfahren Sie über den nebenstehenden Button mehr.

 Archiv des Verschwundenen
Archiv des Verschwundenen
Piuk und Schneider lesen in Köln
 Wem gehört Anne Frank?
Wem gehört Anne Frank?
„Immer wenn ich dieses Lied höre“ von Lola Lafon – Literatur 02/25
 Schrecklich komisch
Schrecklich komisch
Tove Ditlevsens Roman „Vilhelms Zimmer“ – Textwelten 02/25
 Um die Wette dichten
Um die Wette dichten
Best of Poetry Slam am Comedia Theater
 Unsichtbare Krankheiten
Unsichtbare Krankheiten
„Gibt es Pflaster für die Seele?“ von Dagmar Geisler – Vorlesung 01/25
 Mit KI aus der Zwangslage
Mit KI aus der Zwangslage
„Täuschend echt“ von Charles Lewinsky – Literatur 01/25
 Doppelte Enthüllung
Doppelte Enthüllung
„Sputnik“ von Nikita Afanasjew – Literatur 12/24
 Eine wahre Liebesgeschichte
Eine wahre Liebesgeschichte
Thomas Strässles „Fluchtnovelle“ – Textwelten 12/24
 Übergänge leicht gemacht
Übergänge leicht gemacht
„Tschüss und Kuss“ von Barbara Weber-Eisenmann – Vorlesung 11/24
 Die zärtlichen Geister
Die zärtlichen Geister
„Wir Gespenster“ von Michael Kumpfmüller – Textwelten 11/24
 Zurück zum Ursprung
Zurück zum Ursprung
„Indigene Menschen aus Nordamerika erzählen“ von Eldon Yellowhorn und Kathy Lowinger – Vorlesung 10/24
 Eine Puppe auf Weltreise
Eine Puppe auf Weltreise
„Post von Püppi – Eine Begegnung mit Franz Kafka“ von Bernadette Watts – Vorlesung 10/24
Aufwändige Abschlüsse
Comics, die spannend Geschichten zu Ende bringen – ComicKultur 02/25
Massenhaft Meisterschaft
Neue Comics von alten Hasen – ComicKultur 01/25
Gespräch über die Liebe
„In einem Zug“ von Daniel Glattauer – Textwelten 01/25
Kampf den weißen Blättern
Zwischen (Auto-)Biografie und Zeitgeschichte – ComicKultur 12/24
ABC-Architektur
„Buchstabenhausen“ von Jonas Tjäder und Maja Knochenhauer – Vorlesung 11/24
Comics über Comics
Originelle neue Graphic Novels – ComicKultur 11/24