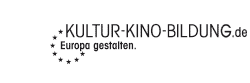An fremden Honigtöpfen naschen
John Banvilles „Die blaue Gitarre“ – Textwelten 10/17
Das Stehlen ist ihm eine Wollust. Es soll nicht unbemerkt bleiben, denn erst, wenn etwas vermisst wird, kann man so recht seinen Wert bemessen. Es ist jener Moment, in dem etwas seinen Besitzer und damit den Radius der Macht wechselt, der das Stehlen in eine unbezwingbare Versuchung verwandelt. Zum ersten Mal erlebt Oliver diesen Thrill als Kind an der Hand seiner Mutter, als er eine Tube Zinkweiß in einem Laden für Malereibedarf verschwinden lässt. Dem Stehlen bleibt er auch dann noch verbunden, als er sich längst schon einen Namen als berühmter Maler erworben hat. Nur stiehlt er jetzt keine Farben mehr, sondern dem besten Freund die Ehefrau.
Zumindest glaubt der Erzähler von John Banvilles neuem Roman „Die blaue Gitarre“ das, und übersieht, dass Frauen nicht mehr Teil eines Besitzstandes sind, sondern gleichfalls handelnde Subjekte. Oliver, der mit der jüngeren, attraktiven Gloria verheiratet ist, beginnt eine Affäre mit Polly, die mit Marcus, dem Uhrmacher, ein Kind hat. Glückliche Stunden verbringen die beiden auf dem Sofa in Olivers Atelier, bis Oliver dann die Einfälle für seine Bilder versiegen. Zugleich erlischt sein Begehren für Polly, als die ihren Ehemann verlässt und er nun gemeinsam mit ihr zu Pollys Eltern auf ein verregnetes Landgut flüchten muss.
John Banville, der Grandseigneur der englischsprachigen Literatur, Gewinner des Man-Booker-Preises, kartographiert unsere Epoche anhand komplexer Geschichten der Liebe und des Begehrens. Noch in seinem letzten Roman „Im Lichte der Vergangenheit“ beschreibt er wie das Begehren zwischen einer älteren Frau und einem Teenager gezündet wird. Den Widersprüchen und der Subversion des Begehrens geht er auch in der Beobachtung der beiden Paare nach. Von Ferne erinnert das Quartett an Goethes „Wahlverwandtschaften“. Dort folgten die Kräfte der Anziehung und Abstoßung den Gesetzen der Naturwissenschaft. Während Goethe dem Partnertausch wuchtige Dramatik verleiht, zieht Banville dem Verlangen sozusagen den Nerv.
Wie verliert das weibliche Objekt des Begehrens seinen Glanz für die Männer, und wie zündet das Verlangen im Kopf einer Frau? Banvilles Maler gibt sich redliche Mühe, die Hässlichkeit des eigenen Narzissmus nicht zu unterschlagen, was uns Lesern wunderbar komische Momente beschert, aber wer zu sehr mit der eigenen Befindlichkeit beschäftigt ist, der ist dann auch mit Blindheit für die Gefühlslagen der anderen geschlagen. Das zeigt der Ire gegen Ende. Nachdem er uns zuvor tief in das verregnete Beziehungsdrama von Oliver und Polly geführt hat, entfaltet Banville ein furioses Finale, bei dem seinem Erzähler Hören und Sehen vergeht. „Die blaue Gitarre“ – der Titel bezieht sich sowohl auf Pollys üppige Hüfte wie auf jenes Bild, das Olivers Scheitern als Maler dokumentiert – ist ein Roman, in dem man alles um sich her vergessen kann. Banville bewährt sich als ein Meister, der uns jederzeit mit seiner sinnlichen Weltbeobachtung zu überraschen versteht. Seine „Wahlverwandtschaften“ führen uns vor Augen, dass die Welt im 21. Jahrhundert nicht gleich untergeht, wenn vier Erwachsene an fremden Honigtöpfen naschen, ohne Konsequenzen bleibt derartige Abwechslung allerdings auch nicht.
John Banville: Die blaue Gitarre | Aus dem Englischen von Christa Schuenke | Verlag Kiepenheuer & Witsch | 352 S. | 18,99 €
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Als unabhängiges und kostenloses Medium sind wir auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell mit einem freiwilligen Betrag unterstützen möchten, dann erfahren Sie über den nebenstehenden Button mehr.

 Archiv des Verschwundenen
Archiv des Verschwundenen
Piuk und Schneider lesen in Köln
 Wem gehört Anne Frank?
Wem gehört Anne Frank?
„Immer wenn ich dieses Lied höre“ von Lola Lafon – Literatur 02/25
 Schrecklich komisch
Schrecklich komisch
Tove Ditlevsens Roman „Vilhelms Zimmer“ – Textwelten 02/25
 Um die Wette dichten
Um die Wette dichten
Best of Poetry Slam am Comedia Theater
 Unsichtbare Krankheiten
Unsichtbare Krankheiten
„Gibt es Pflaster für die Seele?“ von Dagmar Geisler – Vorlesung 01/25
 Mit KI aus der Zwangslage
Mit KI aus der Zwangslage
„Täuschend echt“ von Charles Lewinsky – Literatur 01/25
 Doppelte Enthüllung
Doppelte Enthüllung
„Sputnik“ von Nikita Afanasjew – Literatur 12/24
 Eine wahre Liebesgeschichte
Eine wahre Liebesgeschichte
Thomas Strässles „Fluchtnovelle“ – Textwelten 12/24
 Übergänge leicht gemacht
Übergänge leicht gemacht
„Tschüss und Kuss“ von Barbara Weber-Eisenmann – Vorlesung 11/24
 Die zärtlichen Geister
Die zärtlichen Geister
„Wir Gespenster“ von Michael Kumpfmüller – Textwelten 11/24
 Zurück zum Ursprung
Zurück zum Ursprung
„Indigene Menschen aus Nordamerika erzählen“ von Eldon Yellowhorn und Kathy Lowinger – Vorlesung 10/24
 Eine Puppe auf Weltreise
Eine Puppe auf Weltreise
„Post von Püppi – Eine Begegnung mit Franz Kafka“ von Bernadette Watts – Vorlesung 10/24
Aufwändige Abschlüsse
Comics, die spannend Geschichten zu Ende bringen – ComicKultur 02/25
Massenhaft Meisterschaft
Neue Comics von alten Hasen – ComicKultur 01/25
Gespräch über die Liebe
„In einem Zug“ von Daniel Glattauer – Textwelten 01/25
Kampf den weißen Blättern
Zwischen (Auto-)Biografie und Zeitgeschichte – ComicKultur 12/24
ABC-Architektur
„Buchstabenhausen“ von Jonas Tjäder und Maja Knochenhauer – Vorlesung 11/24
Comics über Comics
Originelle neue Graphic Novels – ComicKultur 11/24