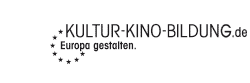Suche nach Halt
Bachtyar Ali bei der Kölner Literaturnacht – Festival 09/21
In diesem Jahr erschien mit „Mein Onkel, den der Wind mitnahm“ ein weiterer Roman des in Köln lebenden irakischen Schriftstellers Bachtyar Ali (55) in deutscher Sprache. Kein leichtes Unterfangen, gibt es doch keine Übersetzer für Sorani, einer Variante des Kurdischen. Ali spricht hier von „Glück“ und „Zufall“. Er habe in Freundeskreisen darauf hingewiesen, dass es seit dem Mittelalter Sorani-Literatur gebe. Ein Freund habe dann zusammen mit einer Freundin begonnen, Alis Roman „Der letzte Granatapfel“ zu übersetzen, den er im deutschen Exil geschrieben hatte. Mit dem schweizerischen Unionsverlag habe man auch unerwartet und sehr schnell einen Partner gefunden – und das ursprünglich 2002 erschienene Buch verschaffte ihm 2016 den Durchbruch in deutscher Sprache, drei weitere Übersetzungen folgten.
Der neue Roman, den er nun bei der Kölner Literaturnacht zusammen mit Moderatorin Ulla Egbringhoff und Vorleserin Janina Sachau vorstellte, mutet wie eine Art magisch-realistischer Schelmenroman an. Dem besonders dünnen und leichten „Onkel, den der Wind mitnahm“ fehlt die Bodenhaftung und er gerät in einer windigen Stadt in immer neue Situationen. Bei jedem Aufprall ist Djamschid wie verwandelt, hat alle seine Vorsätze wieder vergessen und ganz neue Ideen. Er repräsentiert verschiedene religiöse und politische Anschauungen, wird verehrt und gehasst, gefeiert und gefoltert. Der Roman wird von seinem Neffen erzählt. Dabei spielt Ali deutlich auf Gruppierungen, Zugehörigkeiten, Lebenswege und Schicksale im mittleren Osten an, die er selber nicht nur während der Diktatur Saddam Husseins selber erlebte.
Umbrüche im Nahen und Mittleren Osten
Von Ulla Egbringhoff auf Vergangenheitsbewältigung angesprochen, weist Ali auf einen großen Unterschied zwischen Ost und West hin, was die Kontinuität der Lebensumständer angeht. „Die Leute haben innerhalb der letzten Jahrzehnte sehr viele Umbrüche und Machtwechsel erfahren. Und die Erinnerungen sind fast immer sehr schmerzhaft – man muss eigentlich versuchen, zu vergessen, die Bilder aus dem Kopf zu vertreiben. Ich meine, dass das Tempo der Ereignisse uns eigentlich zwingt, das Tempo des Vergessens zu beschleunigen und immer von vorne anzufangen. Wir leben immer im Moment. Wir haben keinen Halt, denn die nächste Katastrophe ist schon unterwegs.“
Ali selbst versuche, die Katastrophen der Region doch erzählbar zu machen. Dabei habe sich die einst besondere kurdische Erfahrung ständiger Veränderung inzwischen auf den ganzen Orient ausgebreitet.
Die Figur des Djamschid Khan sei zum einen von einem psychisch kranken Onkel inspiriert, dem regelmäßige Elektroschock-Behandlungen in Bagdad verschrieben worden waren. „Er hat immer geahnt, wann er dahin muss, hat geweint, hat sich versteckt. Aber wenn er zurückkam, hatte er jedes Mal einen neuen Charakter. Er wollte eigentlich Geschäftsmann werden, einmal wollte er heiraten, einmal wollte er eine Partei gründen.“ Als weiteres Vorbild habe sein sehr dünner, Sportlehrer gedient, „nur Knochen und Haut, aber er war sehr streng. Er wurde von den Schülern gehasst und man hat jede Gelegenheit genutzt, über ihn Witze zu machen. DIe Kinder haben immer gesagt, wenn der Wind wütet, macht er seine Taschen immer voll mit Steinen, damit er am Boden bleibt.“ Der erzählende Neffe sei ein Symbol für Starrheit, Djamschid Khan hingegen stünde für das Werden, die ewige Verwandlung.
„Ein Leben voller Sackgassen“
„Ich finde in seiner Identitätslosigkeit etwas Revolutionäres, weil bei uns im Orient Identität immer etwas Heiliges, etwas Sakrales ist“, erklärt Ali. „Jeder von uns trägt verschiedene Formen und Gestalten in sich. Aber er ist auch eine sehr tragische Figur. Er klammert sich an jede Gestalt und sucht nach einer Identität, aber er kann am Ende keinen Halt finden. Das ist eigentlich ein Roman über den Wind der Geschichte, die Kraft der Verwandlung, über die Menschen und Gesellschaften, die ihre Richtung nicht finden können, die unter der Abwesenheit von Identität leiden, und über unsere eigene Unfähigkeit, eine Identität oder eine Form oder Gestalt zu finden. Djamschid Khan verkörpert eigentlich das Problem der orientalischen Nationen, die sich vor einem Mangel an Identität fürchten, und diese Angst befeuert immer Extremismus. Wenn man Djamschid genau betrachtet, sieht er (die Welt) sehr oft als Extremist. Er ist eine Figur, die immer abstürzt, ist aber nicht der einzige, der die Kontrolle über sein Leben verloren hat. Er ist für mich eigentlich ein Symbol für mein Volk, für meine Generation.“
Sein Bestreben, die Gesellschaft zu verändern, bringt Djamschid oft in Lebensgefahr. „Er findet immer einen Fluchtweg – es sind alles Fluchtwege, die Djamschid benutzt, aber sein Leben ist voller Sackgassen. Am Ende entdeckt er, dass auch der Himmel eine Sackgasse war.“
Die Veranstaltung im Comedia Theater, unter 3G-Regeln und Maskenpflicht, war gemessen an der Kapazität des Saales nicht gut besucht, vielmehr freuten sich bei angenehmen Temperaturen die Bars über voll besetzte Außenbereiche zum Public Viewing des Bundesligaspiels Köln gegen Leipzig.

Foto: Jan Schliecker
Deutsch als Fremdsprache
In der Literaturnacht kamen bei verschiedenen Veranstaltungen weitere Autoren aus dem Orient zu Wort, die nach ihrer Migration mit der deutschen Sprache zu tun haben. Bei einer Veranstaltung in den Räumen der Michael Horbach Stiftung erzählte der 1971 nach Deutschland eingewanderte syrische Schriftsteller und Übersetzer Suleman Taufiq (68): „In einer Fremdsprache zu schreiben, ist man freier.“ Er habe zur deutschen Sprache keine emotionale Beziehung entwickelt, die arabische Muttersprache sei für ihn aber „voller Tabus und Verbote“. Er verglich seine Erfahrung mit dem Hören deutscher Schlagermusik gegenüber englischsprachigen Texten.
Jabbar Abdullah (33), der 2012 aus Syrien flüchtete und seit Mitte 2014 in Köln lebt, berichtete davon, wie er sich damals vergeblich um Unterstützung von einem Verlag bemüht und sich vorgenommen habe, seinen nun erschienenen Bericht über seine Erfahrungen, „Raqqa am Rhein“, zusammen mit einer Freundin, die Deutsch als Fremdsprache unterrichtet, selbstorganisiert aus dem Arabischen zu übersetzen. „Meine Zielgruppe war die Gesellschaft hier, nicht die arabische Gesellschaft.“ Im Laufe der vier Jahre, die benötigt wurden, habe sich sein Sprachniveau nach und nach verbessert. Der Kollege Suleman Taufiq habe dann den Kontakt mit dem Verlag hergestellt.
Die Planungen zur zweiten Kölner Literaturnacht gingen auf die Zeit vor Corona zurück. Zum ursprünglichen Termin im Mai 2020 hatte sie ausfallen müssen. Auf den neuen Termin wurde seit Anfang des Jahres zugearbeitet. Zeitweise musste man wegen monatelang steigender Inzidenzen schon wieder um das Festival bangen. Nun schien zwar der feierliche Aspekt zu fehlen, dafür stimmten aber die Sitzabstände. Auf bessere Zeiten, in denen Festivals wieder Festivals sein können!
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Als unabhängiges und kostenloses Medium sind wir auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell mit einem freiwilligen Betrag unterstützen möchten, dann erfahren Sie über den nebenstehenden Button mehr.

 Archiv des Verschwundenen
Archiv des Verschwundenen
Piuk und Schneider lesen in Köln
 Wem gehört Anne Frank?
Wem gehört Anne Frank?
„Immer wenn ich dieses Lied höre“ von Lola Lafon – Literatur 02/25
 Schrecklich komisch
Schrecklich komisch
Tove Ditlevsens Roman „Vilhelms Zimmer“ – Textwelten 02/25
 Um die Wette dichten
Um die Wette dichten
Best of Poetry Slam am Comedia Theater
 Unsichtbare Krankheiten
Unsichtbare Krankheiten
„Gibt es Pflaster für die Seele?“ von Dagmar Geisler – Vorlesung 01/25
 Mit KI aus der Zwangslage
Mit KI aus der Zwangslage
„Täuschend echt“ von Charles Lewinsky – Literatur 01/25
 Doppelte Enthüllung
Doppelte Enthüllung
„Sputnik“ von Nikita Afanasjew – Literatur 12/24
 Eine wahre Liebesgeschichte
Eine wahre Liebesgeschichte
Thomas Strässles „Fluchtnovelle“ – Textwelten 12/24
 Übergänge leicht gemacht
Übergänge leicht gemacht
„Tschüss und Kuss“ von Barbara Weber-Eisenmann – Vorlesung 11/24
 Die zärtlichen Geister
Die zärtlichen Geister
„Wir Gespenster“ von Michael Kumpfmüller – Textwelten 11/24
 Zurück zum Ursprung
Zurück zum Ursprung
„Indigene Menschen aus Nordamerika erzählen“ von Eldon Yellowhorn und Kathy Lowinger – Vorlesung 10/24
 Eine Puppe auf Weltreise
Eine Puppe auf Weltreise
„Post von Püppi – Eine Begegnung mit Franz Kafka“ von Bernadette Watts – Vorlesung 10/24
Aufwändige Abschlüsse
Comics, die spannend Geschichten zu Ende bringen – ComicKultur 02/25
Massenhaft Meisterschaft
Neue Comics von alten Hasen – ComicKultur 01/25
Gespräch über die Liebe
„In einem Zug“ von Daniel Glattauer – Textwelten 01/25
Kampf den weißen Blättern
Zwischen (Auto-)Biografie und Zeitgeschichte – ComicKultur 12/24
ABC-Architektur
„Buchstabenhausen“ von Jonas Tjäder und Maja Knochenhauer – Vorlesung 11/24
Comics über Comics
Originelle neue Graphic Novels – ComicKultur 11/24