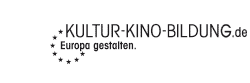Die Erkenntnis der Lust
Eine erste Philosophie des Orgasmus liegt vor – Textwelten 03/19
Wer ihn nicht hat, sollte lieber schweigen. Denn ihn nicht zu haben bedeutet, zu einer bemitleidenswerten Spezies zu gehören, die schnell den Stempel des Versagens aufgedrückt bekommt. In einer Gesellschaft deren Primat das Genießen ist, gehört der Orgasmus zu den Pflichtaufgaben. Tatsächlich weiß man aber nur wenig über jenen Moment, in dem zwei in den Wonnen der Lust miteinander verschmelzen. Der Musikwissenschaftler Claus-Steffen Mahnkopf legt nun im Suhrkamp Verlag eine „Philosophie des Orgasmus“ vor, die eine Art Bestandsaufnahme unseres Wissens über den Höhepunkt menschlicher Lust darstellt. Obwohl der Literatur und dem Film eigene Kapitel gewidmet sind, gibt es hier - wie auch beim Tanz – von ihm eher vorschnelle Urteile, die diesen Künsten nur wenig ergiebige Erkenntnisse über das Erleben des Orgasmus bescheinigen. Keine Frage, dass sich Mahnkopf am besten in der Musik auskennt und dort verortet er auch das kongeniale künstlerische Pendant zu dem, was sich gewöhnlich zwischen den Laken abspielt. Genau genommen bei Richard Wagner und seinem „Tannhäuser“. Wagner kannte die Forschungen von Masters und Johnson nicht, aber seine Intuition deckte sich mit ihren Ergebnissen, die dem Mann einen eher eindimensionalen Orgasmus bescheinigen, der sich nicht gleich wiederholen lässt, während der weibliche komplex und in Wellen nach Fortsetzung verlangt. Die Evolution hat es so eingerichtet und sie hatte ihre guten Gründe dafür.
Mahnkopf ist Geisteswissenschaftler und als solcher leitet er aus den physiologischen Tatsachen die kulturelle Forderung ab, dass der männliche Orgasmus weiblicher sein sollte. Wie sich das konkret vorstellen lässt, bleibt offen, aber der Brückenschlag zu einer Wahrnehmung, die intensiver, reicher, genussvoller und ethischer sein könnte, ist damit vollzogen. Denn es geht bei diesem magischen Moment eben um mehr als ein paar konvulsive Muskelkontraktionen. Was geschieht in uns, dass wir für einen Augenblick Religion und Gott hinter uns lassen und nur noch Gegenwart sind? Mahnkopf rührt viel Wissen aus Kultur und Geisteswissenschaft um, zu philosophischen Schlussfolgerungen kommt er vereinzelt. Obwohl der Orgasmus in klassischer Weise den Moment der Selbstvergessenheit bezeichnet, stellt er zugleich doch ein Erkenntnisinstrument dar. Das Wahrnehmen, Begreifen und Erkennen des anderen kann hier besonders intensiv erlebt werden.
Noch einmal betont Mahnkopf den Ansatz der französischen Philosophie, für die sich das Begehren stets am Anderssein entzündet. Zwei unabhängige Individuen begegnen sich und bleiben auch im Moment höchster Erregung zwei Persönlichkeiten. Mahnkopf weist auf die Spiegelung, die sich dann vollzieht, denn wir bekommen uns selbst immer nur im anderen zu Gesicht. Eine Erfahrung, die wieder und wieder gemacht werden will, gerade weil man einmal erlebt hat, wie besonders sie ist. Die zweite Forderung dieser philosophischen Betrachtung des Glücks besteht denn auch im Appell, den Orgasmus als Teil eines „guten Lebens“ im Dasein zu integrieren. Er steht den Menschen zu, sie haben ihn im Laufe der Evolution in sich entwickelt, nun sollte er Teil einer kulturellen Würde sein, die ihren Platz im Leben der Generationen verlangt. Auch wenn er sich im sozialen Alltag nicht einklagen lässt, so sollte er doch als integraler Teil eines gelingenden Lebens verstanden werden.
Claus-Steffen Mahnkopf: Philosophie des Orgasmus | Suhrkamp Verlag | 248 S. | 12 €
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Als unabhängiges und kostenloses Medium sind wir auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell mit einem freiwilligen Betrag unterstützen möchten, dann erfahren Sie über den nebenstehenden Button mehr.

 Archiv des Verschwundenen
Archiv des Verschwundenen
Piuk und Schneider lesen in Köln
 Wem gehört Anne Frank?
Wem gehört Anne Frank?
„Immer wenn ich dieses Lied höre“ von Lola Lafon – Literatur 02/25
 Schrecklich komisch
Schrecklich komisch
Tove Ditlevsens Roman „Vilhelms Zimmer“ – Textwelten 02/25
 Um die Wette dichten
Um die Wette dichten
Best of Poetry Slam am Comedia Theater
 Unsichtbare Krankheiten
Unsichtbare Krankheiten
„Gibt es Pflaster für die Seele?“ von Dagmar Geisler – Vorlesung 01/25
 Mit KI aus der Zwangslage
Mit KI aus der Zwangslage
„Täuschend echt“ von Charles Lewinsky – Literatur 01/25
 Doppelte Enthüllung
Doppelte Enthüllung
„Sputnik“ von Nikita Afanasjew – Literatur 12/24
 Eine wahre Liebesgeschichte
Eine wahre Liebesgeschichte
Thomas Strässles „Fluchtnovelle“ – Textwelten 12/24
 Übergänge leicht gemacht
Übergänge leicht gemacht
„Tschüss und Kuss“ von Barbara Weber-Eisenmann – Vorlesung 11/24
 Die zärtlichen Geister
Die zärtlichen Geister
„Wir Gespenster“ von Michael Kumpfmüller – Textwelten 11/24
 Zurück zum Ursprung
Zurück zum Ursprung
„Indigene Menschen aus Nordamerika erzählen“ von Eldon Yellowhorn und Kathy Lowinger – Vorlesung 10/24
 Eine Puppe auf Weltreise
Eine Puppe auf Weltreise
„Post von Püppi – Eine Begegnung mit Franz Kafka“ von Bernadette Watts – Vorlesung 10/24
Aufwändige Abschlüsse
Comics, die spannend Geschichten zu Ende bringen – ComicKultur 02/25
Massenhaft Meisterschaft
Neue Comics von alten Hasen – ComicKultur 01/25
Gespräch über die Liebe
„In einem Zug“ von Daniel Glattauer – Textwelten 01/25
Kampf den weißen Blättern
Zwischen (Auto-)Biografie und Zeitgeschichte – ComicKultur 12/24
ABC-Architektur
„Buchstabenhausen“ von Jonas Tjäder und Maja Knochenhauer – Vorlesung 11/24
Comics über Comics
Originelle neue Graphic Novels – ComicKultur 11/24