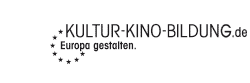Die Hölle im Vorort
Wozu sind Menschen fähig – im Guten wie im Bösen? – Textwelten 06/17
In Triest konnte ihn jeder sehen, den Rauch, der nach Menschenfleisch roch. Denn das einzige Konzentrationslager auf italienischem Boden befand sich im Vorort San Sabba. Das Fabrikgebäude der Reismühle – die Risiera – besaß einen Ofen, in dem Geiseln, Partisanen oder jüdische Bürger verbrannt wurden. Wie kann man einer so bedrängenden Realität ausweichen, wo doch jeder in der Stadt wusste, was dort geschah? Es ist möglich, in Deutschland etwa konnte einer der SS-Kommandanten des Lagers nach dem Krieg unbehelligt weiterleben. In Triest machte man Geschäfte mit der Kommandantur oder vergnügte sich mit den deutschen Offizieren bei eleganten Abendunterhaltungen.
Manchmal glaubt man das Fibrieren des Zorns in der Stimme von Claudio Magris hören zu können, wenn der Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels, in seinem neuen Roman über jene Zeit spricht. Das Buch des Triestiners trägt den programmatischen Titel „Verfahren eingestellt“ und erzählt von zwei Personen. Da ist zunächst ein Sammler von historischem Kriegsgerät, der von der Haubitze bis zum U-Boot alle Gerätschaften zusammenträgt, mit denen Menschen getötet werden können. Er plant ein Museum, „das der Dokumentation des Krieges gewidmet ist, um den Frieden zu preisen“. Ein edles Unterfangen, dessen obsessive Aktivität freilich unter der Hand auch von der Faszination für die Tötungsmaschinen berichtet. Die Obsession ist ihm bewusst und er glaubt sie durch die Suche nach den Namen der Mörder hinter sich lassen zu können, die in die Mauern der Risiera geritzt wurden. Jemand hat die Wände jedoch gekälkt und der Museologe verbrannte eines nachts inmitten seiner Sammlung. Eine junge Kuratorin wird beauftragt, die Exponate zu ordnen. Sie stammt aus einer jüdischen Familie, in der nur die Mutter als Kind die Deportation überlebte. Von der Großmutter wird behauptet, dass sie eine Verräterin gewesen sei. Wahrheit oder üble Nachrede?
Magris schreibt: „Ich kämpfe nicht gegen das Vergessen, sondern gegen das Vergessen des Vergessens… In Triest sehe ich in jeder Straße den Rauch, den man nicht sehen wollte.“ Der Roman stellt sich als gigantisches Fresko zahlreicher Schicksale und Szenen dar, in denen der Krieg im Grunde nur der Auslöser ist, um zu zeigen, wozu Menschen in der Lage sind – im Guten wie im Bösen. Der naiven Vorstellung, dass jemand für die Gewalt und die Verbrechen, die er in der Vergangenheit verübt hat, zur Rechenschaft gezogen würde, gibt sich der Erzähler nicht mehr hin. Dennoch erklärt sich die Gegenwart nicht ohne den Blick auf den Opportunismus, mit dem das Morden vertuscht und damit zu einer Angelegenheit wurde, die ihre Fühler bis in unsere Gegenwart ausstreckt. Magris verwebt die mythische Dimension der Zeit in seine Erzählstimme, ein Stilmittel, mit dem man sich akklimatisieren muss. Aber wer einmal mit Hilfe der eleganten Übersetzung von Ragni Maria Gschwend in diesen Stoff Eingang gefunden hat, wird mit herzzerreißenden Geschichten und wundervollen Erzählbildern belohnt. Tatsächlich ist Claudio Magris dem exzentrischen Sammler begegnet und sein Wissen um die Genese Triests ist unübertroffen faszinierend.
Claudio Magris: Verfahren eingestellt | Aus dem Italienischen von Ragni Maria Gschwend | Hanser | 400 S. | 25 €
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Als unabhängiges und kostenloses Medium sind wir auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell mit einem freiwilligen Betrag unterstützen möchten, dann erfahren Sie über den nebenstehenden Button mehr.

 Archiv des Verschwundenen
Archiv des Verschwundenen
Piuk und Schneider lesen in Köln
 Wem gehört Anne Frank?
Wem gehört Anne Frank?
„Immer wenn ich dieses Lied höre“ von Lola Lafon – Literatur 02/25
 Schrecklich komisch
Schrecklich komisch
Tove Ditlevsens Roman „Vilhelms Zimmer“ – Textwelten 02/25
 Um die Wette dichten
Um die Wette dichten
Best of Poetry Slam am Comedia Theater
 Unsichtbare Krankheiten
Unsichtbare Krankheiten
„Gibt es Pflaster für die Seele?“ von Dagmar Geisler – Vorlesung 01/25
 Mit KI aus der Zwangslage
Mit KI aus der Zwangslage
„Täuschend echt“ von Charles Lewinsky – Literatur 01/25
 Doppelte Enthüllung
Doppelte Enthüllung
„Sputnik“ von Nikita Afanasjew – Literatur 12/24
 Eine wahre Liebesgeschichte
Eine wahre Liebesgeschichte
Thomas Strässles „Fluchtnovelle“ – Textwelten 12/24
 Übergänge leicht gemacht
Übergänge leicht gemacht
„Tschüss und Kuss“ von Barbara Weber-Eisenmann – Vorlesung 11/24
 Die zärtlichen Geister
Die zärtlichen Geister
„Wir Gespenster“ von Michael Kumpfmüller – Textwelten 11/24
 Zurück zum Ursprung
Zurück zum Ursprung
„Indigene Menschen aus Nordamerika erzählen“ von Eldon Yellowhorn und Kathy Lowinger – Vorlesung 10/24
 Eine Puppe auf Weltreise
Eine Puppe auf Weltreise
„Post von Püppi – Eine Begegnung mit Franz Kafka“ von Bernadette Watts – Vorlesung 10/24
Aufwändige Abschlüsse
Comics, die spannend Geschichten zu Ende bringen – ComicKultur 02/25
Massenhaft Meisterschaft
Neue Comics von alten Hasen – ComicKultur 01/25
Gespräch über die Liebe
„In einem Zug“ von Daniel Glattauer – Textwelten 01/25
Kampf den weißen Blättern
Zwischen (Auto-)Biografie und Zeitgeschichte – ComicKultur 12/24
ABC-Architektur
„Buchstabenhausen“ von Jonas Tjäder und Maja Knochenhauer – Vorlesung 11/24
Comics über Comics
Originelle neue Graphic Novels – ComicKultur 11/24