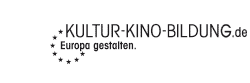Ein Idyll in Trümmerhaufen
Rafik Schami zu Gast im Literarischen Salon im Stadtgarten – Literatur 02/17
Rafik Schami erzählt nicht nur, er seziert. „Die Wüste animiert zum Erzählen, nicht zum Schreiben“, erklärt er die tiefgreifende Tradition der mündlichen Überlieferung in der arabischen Kultur, die sich selbst gegen die Verschriftlichung des Korans lange Zeit wehrte. Keinen Zustand unserer Gegenwart überlässt Schami dem Zufall, führt mal auf geografische, mal auf historische Ursprünge zurück. In diesem Sinne ist Schami nicht nur Autor. Er ist Kulturanthropologe, Genealoge, Historiker und Evolutionsforscher zugleich. Und in aller erster Linie ist er – wie er an diesem Abend im Literarischen Salon im Stadtgarten beweist – noch immer, trotz der Emigration im Jahre 1971 nach Deutschland, ein Kind der Wüste.
Während jeder Autor in Syrien, traumatisiert durch die Herabwürdigung der Kolonialisierung, versucht habe, wie Kafka zu sein, sei das Geschichtenerzählen sein Versuch gewesen, seine Kultur zu retten. So liest Schami bei seinen Lesungen bekanntermaßen nicht. Er erzählt frei. Ein Umstand, der das Feuilleton oft beschäftigt und begeistert hat. Guy Helminger und Navid Kermani, seit 2005 das Gastgeber-Duo des literarischen Salons, wissen das natürlich allzu gut. Und Schami weiß das wiederum zu schätzen: „Ich bin dankbar, dass ihr die Bücher heute zur Seite geschoben habt.“
Erzählen ohne Angst
Als andere Männer im „brunftigen“ Alter Gewichte gestemmt hätten, habe er Geschichten erzählt. Und die Mädchen in Damaskus hätten das geliebt, witzelt der Autor. In Deutschland habe ihm zuweilen nur der Buchhändler, dessen Frau und Schwiegermutter zugehört. Heute ist es der ausverkaufte Stadtgarten – ein Teil der kultivierten literarischen Landschaft in Deutschland, so Schami, für die man ihn andernorts beneide. Hier gebe ihm ein stets höfliches Publikum die nötige Ruhe für seine Kunst. Und tatsächlich ist die Stimmung an diesem Abend so andächtig, dass es nicht einmal Zwischenapplaus gibt. Lediglich ein zustimmendes Grummeln und ein fehlplatziertes Lachen ertönt. Zurückhaltung kann auch wohl die deutschen ZuhörerInnen zuweilen etwas überfordern.
Was der größte Unterschied zwischen dem Erzählen in Syrien und dem in Deutschland sei? „Das Erzählen in Freiheit ist ganz anders als das Erzählen in Angst“, sagt Schami. So dauert es nicht lange, bis sich der Literarische Salon an diesem Abend unentbehrlich in einen politischen Salon wandelt. Denn Schamis Geschichten erwachsen zwar aus der Erfahrung des Alltäglichen; sie handeln mal von einer unglücklichen Liebe, mal schreibt er Kinderbücher. Doch gedeiht all dies in einem politischen Raum, der Schami ins Exil trieb.
„Wäre ich in Damaskus geblieben, wäre ich verstummt“
Das Damaskus, das er in seinen Erzählungen sehnsüchtig und virtuos ausmalt, diese Stadt, die morgens erwacht wie „ein verwöhntes Mädchen“, hat der Autor mitunter gehasst. Die staatliche Zensur habe seine Texte bis ins Unkenntliche verunstaltet. „Wäre ich in Damaskus geblieben, wäre ich verstummt.“ Oder er wäre im Gefängnis gelandet. Doch es ist nicht nur der politische Apparat, der das Aufkeimen der Kreativität, ein Sprössling der Freiheit, verhindert. „Die Sippe erstickt dich!“, so Schami über eine Gesellschaft, die zwanghaft an einem streng patriarchisch organisierten Familienbild festhält: „Die Sippe ist eine Miniatur der Diktatur.“ Was er damit meint, macht eine von seinen zahlreichen amüsanten Geschichten des Abends deutlich: Als er noch die Universität in Damaskus besucht habe, die außerhalb des Stadtkerns lag, sei er eines Tages, sich in Sicherheit wiegend, mit seiner Freundin Hand in Hand herumgestreift. So wie es der Zufall wollte, fuhr gerade an diesem Tag eine Tante dritten Grades im Bus an dem Pärchen vorbei. Noch bevor Schami am Abend heimkehrte, wusste die Mutter Bescheid – eine Diktatur mit einem höchst effizienten Geheimdienst.
In der Wahrnehmung seiner Heimatstadt, so Schami, stelle hingegen der Beginn der politischen Diktatur einen Bruchpunkt dar. „Er hat uns die Perfektion gebracht“, sagt er über Baschar al-Assads Vater und Vorgänger Hafiz al-Assad. Dieser war 1971 nach einem Putsch zum Präsidenten aufgestiegen. Stück für Stück sei der öffentliche Raum, die Straßen, die Schami mehr erzogen hätten als seine Eltern, politisiert worden und das Idyll der Kindheit vernichtet. So weist Helminger folgerichtig darauf hin, dass in Schamis Roman „Sophia oder Der Anfang aller Geschichten“ der Protagonist in ein Damaskus zurückkehrt, das weniger Idyll als eine Katastrophe ist. Heute sei Syrien kein Land mehr, so Schami, sondern eine Kriegsarena der Interessen. „Unser Pech ist: Keiner kann den anderen besiegen.“
Trümmer in den Herzen
Dennoch: Das Idyll existiert fort in Schamis Vorstellung: ein Idyll, das aus der Sehnsucht entsteht. Ohne diese Sehnsucht kann es keine Erzählung geben, wie Kermani mit Zustimmung Schamis festhält. Sehnsucht – und da scheint wieder der große Pragmatiker in Schami durch – ist eine Frage der geografischen Distanz. „Ich schreibe, um die Sehnsucht zu mildern, doch es wird nur schlimmer.“ Dabei formuliert der Autor in seinem Buch „Damaskus im Herzen und Deutschland im Blick“ gleichsam eine Bedienungsanleitung gegen die „Verklärung der Ferne“. Kermani trägt vor: täglich Berichte über die Stadt lesen, wöchentlich Oppositionelle treffen. Gerade jetzt sollte es doch einfacher sein denn je. Doch es funktioniert nicht.
Mehr als ein politischer Autor steht Schami an diesem Abend bei dem Thema als ein Betroffener da. Er erzählt von jungen Christen, die Assad als ihren Schutzherren verteidigen. Er erzählt von seiner Lieblingsschwester, die trotz ihrer liberalen Haltung eine muslimische Freundin nicht mehr besuchen will. Er erzählt von den Trümmern in den Herzen, die ihm mehr Angst machen als die Trümmer auf den Straßen. Auch er, so wirkt es, kann sich in den Fäden dieser Tragödie verfangen. Von Anfang an habe er vor bewaffneten Akteuren bei den Aufständen gewarnt, so Schami. Doch bedauert er ebenso die militärische Zurückhaltung der Amerikaner unter Barack Obama und der Franzosen. Schami ist ein Meister der Geschichten, doch der Krieg in Syrien ist ein Prozess ohne absehbares Ende, der überwältigt und zerreißt.
Wie alle geladenen AutorInnen beim literarischen Salon hat auch Rafik Schami an diesem Abend nicht nur Musik mitgebracht, sondern auch Literatur – jedoch nicht als Autor, sondern als Herausgeber. Fadi Azzams „Sarmada“ hat er etwa im Gepäck. Helminger liest an seiner Stelle vor. Eine Ballade der berühmten libanesischen Sängerin Fairuz läutet das Ende der Veranstaltung ein. Schami schaut dabei tief und nachdenklich in sein Wasserglas. Man mag in diesem Moment nicht in seinem Kopf stecken, in dem sich wahrscheinlich mehr eine großartig vielfältige und doch erschütternde Welt erstreckt als eine Wüste.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Als unabhängiges und kostenloses Medium sind wir auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell mit einem freiwilligen Betrag unterstützen möchten, dann erfahren Sie über den nebenstehenden Button mehr.

 Archiv des Verschwundenen
Archiv des Verschwundenen
Piuk und Schneider lesen in Köln
 Wem gehört Anne Frank?
Wem gehört Anne Frank?
„Immer wenn ich dieses Lied höre“ von Lola Lafon – Literatur 02/25
 Schrecklich komisch
Schrecklich komisch
Tove Ditlevsens Roman „Vilhelms Zimmer“ – Textwelten 02/25
 Um die Wette dichten
Um die Wette dichten
Best of Poetry Slam am Comedia Theater
 Unsichtbare Krankheiten
Unsichtbare Krankheiten
„Gibt es Pflaster für die Seele?“ von Dagmar Geisler – Vorlesung 01/25
 Mit KI aus der Zwangslage
Mit KI aus der Zwangslage
„Täuschend echt“ von Charles Lewinsky – Literatur 01/25
 Doppelte Enthüllung
Doppelte Enthüllung
„Sputnik“ von Nikita Afanasjew – Literatur 12/24
 Eine wahre Liebesgeschichte
Eine wahre Liebesgeschichte
Thomas Strässles „Fluchtnovelle“ – Textwelten 12/24
 Übergänge leicht gemacht
Übergänge leicht gemacht
„Tschüss und Kuss“ von Barbara Weber-Eisenmann – Vorlesung 11/24
 Die zärtlichen Geister
Die zärtlichen Geister
„Wir Gespenster“ von Michael Kumpfmüller – Textwelten 11/24
 Zurück zum Ursprung
Zurück zum Ursprung
„Indigene Menschen aus Nordamerika erzählen“ von Eldon Yellowhorn und Kathy Lowinger – Vorlesung 10/24
 Eine Puppe auf Weltreise
Eine Puppe auf Weltreise
„Post von Püppi – Eine Begegnung mit Franz Kafka“ von Bernadette Watts – Vorlesung 10/24
Aufwändige Abschlüsse
Comics, die spannend Geschichten zu Ende bringen – ComicKultur 02/25
Massenhaft Meisterschaft
Neue Comics von alten Hasen – ComicKultur 01/25
Gespräch über die Liebe
„In einem Zug“ von Daniel Glattauer – Textwelten 01/25
Kampf den weißen Blättern
Zwischen (Auto-)Biografie und Zeitgeschichte – ComicKultur 12/24
ABC-Architektur
„Buchstabenhausen“ von Jonas Tjäder und Maja Knochenhauer – Vorlesung 11/24
Comics über Comics
Originelle neue Graphic Novels – ComicKultur 11/24