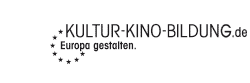Gewalt
Jörg Baberowski räumt mit pazifistischen Illusionen auf – Literatur 12/15
Schockiert stehen wir vor der Kaltblütigkeit der islamistischen Terroristen, die in Paris Konzertbesucher massakrieren. Wir reagieren fassungslos auf die Nachrichten von Steinigungen oder Ermordungen von Kindern oder alten Frauen, die im Namen des IS begangen werden. Frieden und Gewaltlosigkeit verstehen wir als den Normalzustand unseres Zusammenlebens, Gewalt erscheint uns als eine Perversion. Mit den Morden in Paris wurde einmal mehr deutlich, dass uns noch während das Blut der Getöteten trocknet, nur die eine Frage interessiert: „Warum?“ Eine Frage, die uns auch die Nazis nie wirklich beantworten konnten, wenn man sie nach dem Grund für ihr Handeln befragte. Aber wir ertragen es nicht, keine Erklärung zu bekommen. Deshalb ist es ein Skandal, wenn der Historiker Jörg Baberowski sagt: „Die Suche nach dem Ursprung der Gewalt ist vergeblich.“
„Nicht die Gewalt ist das Rätsel, sondern dass wir uns über sie wundern“ meint Baberowski. Der Berliner hatte in seinem Buch „Verbrannte Erde“ die Gewaltgeschichte der Sowjetunion rekonstruiert, jetzt legt er unter dem Titel „Räume der Gewalt“ eine gleichfalls brillante Analyse des Gewaltphänomens vor. Für Baberowski ist die Bestie im Menschen immer präsent, deshalb kann sie auch durch den dünnen Firnis der Ethik jederzeit leicht aktiviert werden. Die Räume müssen gegeben sein, und die entstehen dort, wo man dem anderen das Menschsein abspricht, wenn sich das Töten dann noch in der Gruppe vollzieht, möglichst so, dass man dem Opfer nicht in die Augen sehen muss, scheint alles möglich. Nationalsozialismus und Stalinismus haben es vorgemacht.
Jörg Baberowski schaut in die Vergangenheit und stellt fest, dass es Gewalt immer gab, nicht nur vereinzelt, sondern auch in Pogromen und Massakern an Gefangenen. Mit dem Blick auf Norbert Elias bemerkt er, dass die Allgegenwart von Mord, Verstümmelung oder Folter eingedämmt wurde, als man mit veränderten Handels- Wirtschaftsbedingungen erkannte, dass sich das Töten nicht rechnete. Mit einem ethischen Fortschritt scheint diese Entwicklung wenig zu tun zu haben. Relative Sicherheit für den Einzelnen stellte sich erst mit der Moderne ein. Deren Fundament war die Aufklärung, aber gerade in der Moderne steigen die Zahlen der Gewaltopfer in ein Ausmaß, das innerhalb der Menschheitsgeschichte ohne Vergleich ist. Folgt man Baberowski, dann wären diese Völkermorde auch zu jeder anderen Zeit denkbar gewesen, allein in der Moderne besaß man die Möglichkeiten, sie zu realisieren.
Baberowskis engagiert geschriebener Essay streift alle moralischen und weltanschaulichen Illusionen vom friedliebenden Zusammenleben ab. Ja, gegen die Friedensapostel scheint sein provokanter Ton gerichtet zu sein. Ein verhaltener Zorn klingt aus den Argumentationen, die mit Verve vorgetragen werden, und die davon ausgehen, dass Gewalt als ein Teil der menschlichen Konstitution zu denken ist. Daraus leitet sich aber keine Entlastung der Täter ab. Der Verweis auf die sozialen Verhältnisse als Brutstätte der Gewalt, wie es jetzt in der Diskussion um die Integrationspolitik in Frankreich geschieht, wäre völlig verfehlt. Einen anderen Menschen zu töten, hat nichts mit Armut und sozialer Benachteiligung zu tun. Diskriminierte werden nicht automatisch zu Mördern.
Was kann helfen? Ein demokratischer Staat mit Gesetzen, an die sich alle halten müssen, damit Vertrauen entsteht und dessen Institutionen dem Bürger stets einsichtig bleiben. Andererseits beginnt der Horror in dem Moment, indem der Staat in die Hände politischer Verbrecher fällt. Wir wissen, was dann geschieht.
Jörg Baberowski: Räume der Gewalt | S. Fischer Verlag | 266 S. | 19,99 €
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Als unabhängiges und kostenloses Medium sind wir auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell mit einem freiwilligen Betrag unterstützen möchten, dann erfahren Sie über den nebenstehenden Button mehr.

 Archiv des Verschwundenen
Archiv des Verschwundenen
Piuk und Schneider lesen in Köln
 Schrecklich komisch
Schrecklich komisch
Tove Ditlevsens Roman „Vilhelms Zimmer“ – Textwelten 02/25
 Wem gehört Anne Frank?
Wem gehört Anne Frank?
„Immer wenn ich dieses Lied höre“ von Lola Lafon – Literatur 02/25
 Um die Wette dichten
Um die Wette dichten
Best of Poetry Slam am Comedia Theater
 Unsichtbare Krankheiten
Unsichtbare Krankheiten
„Gibt es Pflaster für die Seele?“ von Dagmar Geisler – Vorlesung 01/25
 Mit KI aus der Zwangslage
Mit KI aus der Zwangslage
„Täuschend echt“ von Charles Lewinsky – Literatur 01/25
 Doppelte Enthüllung
Doppelte Enthüllung
„Sputnik“ von Nikita Afanasjew – Literatur 12/24
 Eine wahre Liebesgeschichte
Eine wahre Liebesgeschichte
Thomas Strässles „Fluchtnovelle“ – Textwelten 12/24
 Übergänge leicht gemacht
Übergänge leicht gemacht
„Tschüss und Kuss“ von Barbara Weber-Eisenmann – Vorlesung 11/24
 Die zärtlichen Geister
Die zärtlichen Geister
„Wir Gespenster“ von Michael Kumpfmüller – Textwelten 11/24
 Zurück zum Ursprung
Zurück zum Ursprung
„Indigene Menschen aus Nordamerika erzählen“ von Eldon Yellowhorn und Kathy Lowinger – Vorlesung 10/24
 Eine Puppe auf Weltreise
Eine Puppe auf Weltreise
„Post von Püppi – Eine Begegnung mit Franz Kafka“ von Bernadette Watts – Vorlesung 10/24
Aufwändige Abschlüsse
Comics, die spannend Geschichten zu Ende bringen – ComicKultur 02/25
Gespräch über die Liebe
„In einem Zug“ von Daniel Glattauer – Textwelten 01/25
Massenhaft Meisterschaft
Neue Comics von alten Hasen – ComicKultur 01/25
Kampf den weißen Blättern
Zwischen (Auto-)Biografie und Zeitgeschichte – ComicKultur 12/24
ABC-Architektur
„Buchstabenhausen“ von Jonas Tjäder und Maja Knochenhauer – Vorlesung 11/24
Auch Frauen können Helden sein
„Die Frauen jenseits des Flusses“ von Kristin Hannah – Literatur 11/24