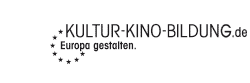Große Krisen und kleine Epiphanien
Lukas Bärfuss zu Gast im Odeon – Literatur 02/20
Auch wenn Lukas Bärfuss gerade mit seinem neuen Buch „Malinois“ auf Lesereise unterwegs ist, kommt man nicht umhin über das letzte Jahr zu sprechen. 2019 erhielt der Schweizer Schriftsteller und Dramatiker den Georg-Büchner Preis, die renommierteste Auszeichnung, die ein Schriftsteller aus dem deutschsprachigen Raum erhalten kann. Danach sah es allerdings lange Zeit nicht aus. Nach der Primarschule jobbte Bärfuss als Tabakbauer, Gärtner und Gabelstaplerfahrer. Erst nach seiner Zeit in der Rekrutenschule bei der Schweizer Armee kam seine literarische Karriere in Fahrt.
Mit Stücken wie „Meienbergs Tod“ und „Die sexuellen Neurosen unserer Eltern“ (2015 verfilmt mit Victoria Schulz und Lars Eidinger) feierte er seit den 90 Jahren in der Schweiz große Erfolge als Bühnenautor und Theaterregisseur, inszenierte in der Folge auch an den großen deutschen Häusern. In seinen Arbeiten schlägt Bärfuss immer wieder den Bogen vom individuellen Schicksal zu gesellschaftlichen und politischen Diskursen. Etwa wenn er sich mit der Sterbehilfe auseinandersetzt, wie in „Alices Reise in die Schweiz“. Oder mit der Zurückweisung der Naziverfolgten an der Schweizer Grenze in „Zwanzigtausend Seiten“. Auch in seinen Romanen wie „Hundert Tage“, wo er den Völkermord in Ruanda und die Rolle der Entwicklungshilfe thematisiert, wird aus der individuellen Erfahrung der Stoff für gesellschaftliche Diskurse. Nach „Koala“ und „Hagard“ folgte dann letztes Jahr der Büchner-Preis.
Die Schweizer Berührungsreliquie
Gerrit Völker, Moderator des Abends, wollte das Thema gleich zu Beginn abhaken, bevor Bärfuss vor dem zahlreich erschienenem Publikum im Odeon-Kino aus seinem neuen Erzählband liest. Wie also fühlt sich das an, so als Büchner-Preisträger? Dem Schriftsteller wurde diese Frage sicher nicht zum ersten Mal gestellt. Dementsprechend fiel seine Reaktion aus: „Können wir nicht über etwas anderes sprechen?“ Nur um dann doch noch kurz auszuholen. Klar, er freue sich. Doch der große Hype, gerade in seiner Schweizer Heimat, ist ihm auch sichtlich unangenehm: „Die Schweizer drehen durch. Für die bin ich schon zur Berührungsreliquie geworden.“

Bei der Lesung im Odeon, von der Maternus Buchhandlung veranstaltet, die gleich gegenüber vom Kino beheimatet ist, tat Bärfuss alles, um diese quasi-religiöse Verehrung zu unterlaufen. Im Kinosaal präsentierte sich der Schriftsteller, in strengem Schwarz gekleidet, umgänglich und kokett, mit sicherem Gespür für die Pointe. Warum sein neues Buch „Malinois“ den Namen einer Hunderasse trage? „Mir ist aufgefallen, dass in meinen Geschichten viele Hunde vorkommen“, so die lapidare Antwort.
In „Malinois“ versammelt Bärfuss dreizehn Kurzgeschichten, die in den letzten zwanzig Jahren entstanden sind. Manche davon bisher unveröffentlicht, andere in Zeitschriften oder Anthologien erschienen, die nicht mehr herausgegeben werden. Das Projekt, erzählt Bärfuss, sei schon lange geplant gewesen. Die Umsetzung bereitete ihm aber immer wieder Unbehagen. Geschichten zu veröffentlichen, die er vor so langer Zeit geschrieben habe, das fühle sich an wie ein „Offenbarungseid. Als könnten die Leute sehen, welche Frisur ich vor zwanzig Jahren getragen habe“.
Mit seinem wunderbar mäandernden Schweizer Akzent setzt er dann aber doch an, aus der ersten Erzählung „Was ist Liebe“ zu lesen. Schon in den ersten Zeilen wird auf die Ausgangsfrage im Titel geantwortet: „Eine Fürchterlichkeit natürlich; eine Wildnis, die Unterstand verspricht; ein schrecklicher Wille zur Unordnung, der sich hinter Ritualen verbirgt.“
Das ist durchaus programmatisch zu verstehen. Alle Erzählungen in „Malinois“ kreisen in lakonischer Tonart um die Leidenschaft und das Begehren eines Individuums, das sich als blinder Wille seinen Weg in das Schicksal fräst – und die dieses Schicksal dann unbarmherzig in die Krise lenken. Sei es die plötzlich entdeckte Homosexualität und die Schwärmerei für den Schwager in „Was ist Liebe“, die Leidenschaft für Drogen in „Haschisch“ oder die Sehnsucht nach der verstorbenen Mutter in „Erinnerungen an den Dramatiker Martin Babian“. Permanent wird der Ergriffene von seinen Leidenschaften verzehrt. Das Begehren ist hier Bedrohung, das sein Opfer überfällt.
Das utopische Potenzial der Literatur
Gerrit Völker will es genauer wissen. Bei allen Protagonisten in „Malinois“ breche schlagartig etwas auf, stürze die vorher fein geordnete Welt in heilloses Chaos. Wie komme diese Faszination für den Zusammenbruch?
„Was mich daran interessiert, ist die Möglichkeit der Epiphanie“, erklärt Bärfuss. „Die Krise beherbergt immer auch die Chance, einen neuen Blick auf die Welt zu entwerfen.“ Die Ausnamesituation wird in Bärfuss' Prosa zum Moment kathartischer Erkenntnis. Auf den ersten Blick wirkt das erstaunlich psychologisierend, erstaunlich unpolitisch für einen Autoren wie ihn.
Geradezu wie ein Appell für die Innerlichkeit lesen sich auch Zeilen in der titelgebenden Geschichte „Malinois“: „Welche Länder lohnen sich noch zu erforschen als die inneren Kontinente, und welche Geschichte sollte noch erzählt werden als die Geschichte unseres Bewusstseins?“
Doch das will Bärfuss so nicht stehen lassen. Und wird grundsätzlich. Literatur, da halte er es mit Platon, sei ein Krisensymptom. „In einer perfekten Gesellschaft bräuchte es die Literatur nicht.“ Als Laboratorium biete die Literatur aber Platz für eine existenziell andere Welterfahrung, für Utopisches. Die Protagonisten in „Malinois“ entwickeln gerade durch die Gewalt und den Krisensituationen, denen sie begegnen, ebenjenen anderen Blick, der Platz macht für alternative Entwürfe der Welt.
Daraus lasse sich lernen. „Menschen hassen Veränderungen. Selbst dann, wenn die Krisen eigentlich schon unerträglich erscheinen.“ Als „Aufruf, sich diesen Krisen zu stellen“, auch und gerade den politischen, verstehe er seine Prosa. Sodass aus der Erfahrung individueller Krisen in der Literatur irgendwann auch mal gesellschaftliche Utopien erwachsen können.
Lukas Bärfuss: Malinois. Erzählungen | Wallstein Verlag | 128 S. | 18 €
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Als unabhängiges und kostenloses Medium sind wir auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell mit einem freiwilligen Betrag unterstützen möchten, dann erfahren Sie über den nebenstehenden Button mehr.

 Archiv des Verschwundenen
Archiv des Verschwundenen
Piuk und Schneider lesen in Köln
 Wem gehört Anne Frank?
Wem gehört Anne Frank?
„Immer wenn ich dieses Lied höre“ von Lola Lafon – Literatur 02/25
 Schrecklich komisch
Schrecklich komisch
Tove Ditlevsens Roman „Vilhelms Zimmer“ – Textwelten 02/25
 Um die Wette dichten
Um die Wette dichten
Best of Poetry Slam am Comedia Theater
 Unsichtbare Krankheiten
Unsichtbare Krankheiten
„Gibt es Pflaster für die Seele?“ von Dagmar Geisler – Vorlesung 01/25
 Mit KI aus der Zwangslage
Mit KI aus der Zwangslage
„Täuschend echt“ von Charles Lewinsky – Literatur 01/25
 Doppelte Enthüllung
Doppelte Enthüllung
„Sputnik“ von Nikita Afanasjew – Literatur 12/24
 Eine wahre Liebesgeschichte
Eine wahre Liebesgeschichte
Thomas Strässles „Fluchtnovelle“ – Textwelten 12/24
 Übergänge leicht gemacht
Übergänge leicht gemacht
„Tschüss und Kuss“ von Barbara Weber-Eisenmann – Vorlesung 11/24
 Die zärtlichen Geister
Die zärtlichen Geister
„Wir Gespenster“ von Michael Kumpfmüller – Textwelten 11/24
 Zurück zum Ursprung
Zurück zum Ursprung
„Indigene Menschen aus Nordamerika erzählen“ von Eldon Yellowhorn und Kathy Lowinger – Vorlesung 10/24
 Eine Puppe auf Weltreise
Eine Puppe auf Weltreise
„Post von Püppi – Eine Begegnung mit Franz Kafka“ von Bernadette Watts – Vorlesung 10/24
Aufwändige Abschlüsse
Comics, die spannend Geschichten zu Ende bringen – ComicKultur 02/25
Massenhaft Meisterschaft
Neue Comics von alten Hasen – ComicKultur 01/25
Gespräch über die Liebe
„In einem Zug“ von Daniel Glattauer – Textwelten 01/25
Kampf den weißen Blättern
Zwischen (Auto-)Biografie und Zeitgeschichte – ComicKultur 12/24
ABC-Architektur
„Buchstabenhausen“ von Jonas Tjäder und Maja Knochenhauer – Vorlesung 11/24
Comics über Comics
Originelle neue Graphic Novels – ComicKultur 11/24