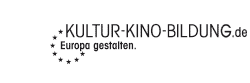In bester Gesellschaft
q[lit]*clgn-Panel über die queere Diaspora in Deutschland – Festival 03/18
Das erste feministische Literaturfestival Deutschlands neigte sich Samstag seinem Ende zu. Mit einem Panel über die Identitätsfindung der queeren Diaspora in Deutschland mit JournalistIn Hengameh Yaghoobifarah, Poetin Moona Moon und der Künstlerin Moshtari Hilal sowie anschließender Party im Studio 672 wurde die ereignisreiche Woche gebührend beendet.
Rund um den Weltfrauen*tag, vom 4. bis 10. März, präsentierte der Verein q[lit]*clgn e.V. ein Programm aus Lesungen, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen und Parties, in welchem die intersektionale Verflechtung unterschiedlicher Diskriminierungsformen aus postkolonial-feministischer Perspektive untersucht wurde. Cis-Gender und Heterosexualität geben fast überall auf der Welt die Normen vor. Auch die feministischen Theorien sind heute hauptsächlich vom „Westen“ geprägt. Bei der q[lit]*clgn wurde aufgezeigt, das andere, inklusive, Realitäten möglich sind.
Dabei sind vor allem Literatur und Sprache von Bedeutung. „Beim Journalismus kann man einfach ein Detail betonen, weglassen oder übersehen“, erklärt taz- und Missy Magazine-AutorIn Hengameh Yaghoobifarah. So leicht kann man verfälscht informieren, Personen aus dem Diskurs ausschließen, Sichtweisen verschieben und Situationen radikalisieren. Moona Moon, Poetin und Sozialpädagogin, drückt es treffend aus: „Mit der Sprache gestalten wir Realität.“ Und an der gibt es noch einiges zu verändern. Mit einer Woche voller restlos ausverkaufter Events scheint das Festival einen Nerv getroffen zu haben.
Auf der Website des Vereins q[lit]*clgn e.V. wird die aktuelle Ungleichheit in der Literaturwelt zusammengefasst: „Männer gewinnen heute im Schnitt fünf Mal häufiger hochdotierte Literaturpreise als Frauen* und auch die Jurys bestehen kumuliert nur zu 23 Prozent aus Juror*innen. Wenn doch, dann sind größtenteils Frauen* aus der weißen Mehrheitsgesellschaft repräsentiert.“ Auch bei der lit.Cologne, die parallel, zwischen dem 6. und 17. März, stattfindet, sind von allen Mitwirkenden, das heißt ModeratorInnen, AutorInnen und MusikerInnen, 43% Frauen*, eine ganz gute Zahl, aber – wie eigentlich immer – demütig unter der Hälfte.
[Und in Kölns sonst auch häufig erschreckend antifeministischer Kulturlandschaft, in der eine rassistisch, sexistisch und dümmlich-skandalleckende Adaption des Romans „Unterwerfung“ von Michel Houellebecq unter Beifall der Zuschauer im Theater im Keller konsumiert wird und in der in dem Hipster-Stück „Nur noch Utopien sind noch realistisch“ (Studiobühne Köln) kolonialistisch über die netten Leute und das gute Essen bei der egozentrischen Selbstsuche in „fernen“ Ländern gefaselt wird und der Darsteller sich als politisch emanzipierte Frau deklariert und dann zugrunde geht, weil Frauen ja Männer brauchen, aber man das als politisch emanzipierte Frau unterdrückt, ist sehr, ja wirklich sehr leicht nachzuvollziehen, dass man sich mal eine andere Kulturgestaltung wünscht.]
Statt wie üblich „Quoten-Frauen*“ in männlich dominierten Diskussionsrunden zu erleben, konnte man bei der q[lit]*clgn ausschließlich Frauen* of colour auf der Bühne sehen. „Empowernd“ und „heilend“ sind Worte, die am Abend genutzt werden, um die positiven Festival-Erfahrungen zu beschreiben. Das eins davon englisch ist, ist im feministischen Diskurs nichts Besonderes. Moona Moon erklärt: „Der feministische Diskurs ist ein internationaler, da sind lokale Sprachen oft weniger relevant. Häufig gibt es auch keine äquivalenten Begriffe im deutschen zur englischen Sprache.“ – „Und manchmal gibt es auch äquivalente deutsche Begriffe“, ergänzt Yaghoobifarah, „aber die haben oft nicht denselben Diskurs wie englische erfahren, und dann benutzt man lieber die englischen. Zum Beispiel ‚fat activism‘. Während im Englischen ‚fat‘ eine gängige Selbstbeschreibung für dicke Menschen ist, wird sie hier eher negativ konnotiert.“
Laut Yaghoobifarah sind die meisten intersektionalen feministischen Themen schon sehr ausführlich behandelt worden, während der deutsche Diskurs hinterherhinke: „Leider ist in Deutschland in 2018 noch vieles bahnbrechend. Wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Es gibt oft nur eine Position.“
Die Diskussionen über Queerness in der Diaspora finde in Deutschland laut Moona Moon eigentlich nur an Küchentischen statt: „Trotzdem bin ich für alle Küchentische Berlins sehr dankbar. Dort sind die Diskussionen am wohltuendsten.“
Für die Arbeiten der drei PanelteilnehmerInnen hilft es, durch ein wenig Abstand ihre persönlichen Erfahrungen und Kritik in die Öffentlichkeit zu vermitteln. Während bei Moona Moon oft die englische Sprache als „Puffer“ dient, fungieren in Hilals Illustrationen vor allem schwarzhaarige Mädchen mit Damenbart als Metapher: „Behaarung war immer ein Thema, das mich gehemmt hat, mich als eine vollständige Person zu fühlen und an der Öffentlichkeit teilzunehmen. Mit meinen Bildern habe ich einen Weg gefunden, ohne voyeuristisch oder besonders biografisch und privat sein zu müssen, mit meiner Identität rauszugehen und mit Körperlichkeiten umzugehen.“
Vor der Vermarktung von Lebensgeschichten warnt Hilal, denn das könne reale Erfahrungen verklären. Yaghoobifarah sieht es ebenfalls kritisch: „Es wird lange dauern bis es Kunst gibt, die mit Positionalitäten einhergeht, ohne dass die Personalitäten das einzige sind, was sich bezahlt macht. Ich nehme auch oft eine ‚Selbst-Exotisierung‘ bei Menschen of color wahr, die es weißen Menschen wieder ermöglicht, bestimmte Dinge zu sagen oder zu fragen, die mit Klischees einhergehen.“
Denn Identitäten wie auch Körperlichkeiten sind vielfältig und lassen sich nicht einfach durch die Herkunft definieren. Moon stellt klar, dass es nicht nur „die eine“ Diaspora-Geschichte gibt: „Für meinen Vater bedeutet Diaspora viel mehr Sehnsucht und Enttäuschung, während es für mich weniger ortsbezogen ist, was nicht bedeutet, dass ich zwischen Orten zerrissen bin. Es ist ein ‚Sowohl... als auch‘ anstelle eines ‚Entweder...oder‘. Und was ist schon echt arabisch? Wo hole ich mir das Zertifikat oder kann sagen, dass ich das nicht wirklich bin?“ – „Was ich gelernt habe, was „typisch afghanisch“ bedeuten soll“, erklärt Moshtari Hilal, „war die Erziehung meiner Großeltern. Aber da hörte es schon auf. Damit muss ich mich nicht mehr auseinandersetzen.“ Mittlerweile und an diesem Abend sei sie sie ja in bester Gesellschaft.
Fast so persönlich wie die von Moona Moon beschriebenen Diskussionen an Berliner Küchentischen fühlt sich das Panel der q[lit]*clgn an und machte den ZuschauerInnen Lust, viele Fragen zu stellen und ihre eigenen Erfahrungen als in der Diaspora lebenden Menschen zu teilen. Die Themen waren scharf und gründlich analysiert, ohne an ihrer Schwere zu erliegen. Hengameh Yaghoobifarah, die in der Runde neben ihren Beiträgen auch moderiert hat, prägte die Sprachgestaltung mit Witz. Neben den vielen fachlichen Bezeichnungen der intersektional-feministischen Theorien warf Yaghoobifarah immer wieder popkulturell-umgangssprachliche Begriffe ein, die sie im Alltag verankerten. Unterhaltsam – ohne sexistisch oder rassistisch zu sein, können nur wenige. Mit mehr Initiativen wie der q[lit]*clgn könnte sich das aber in Zukunft ändern.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Als unabhängiges und kostenloses Medium sind wir auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell mit einem freiwilligen Betrag unterstützen möchten, dann erfahren Sie über den nebenstehenden Button mehr.

 Archiv des Verschwundenen
Archiv des Verschwundenen
Piuk und Schneider lesen in Köln
 Wem gehört Anne Frank?
Wem gehört Anne Frank?
„Immer wenn ich dieses Lied höre“ von Lola Lafon – Literatur 02/25
 Schrecklich komisch
Schrecklich komisch
Tove Ditlevsens Roman „Vilhelms Zimmer“ – Textwelten 02/25
 Um die Wette dichten
Um die Wette dichten
Best of Poetry Slam am Comedia Theater
 30 Alben Musikerfahrung
30 Alben Musikerfahrung
Sylvie Courvoisier Trio im Stadtgarten
 Unsichtbare Krankheiten
Unsichtbare Krankheiten
„Gibt es Pflaster für die Seele?“ von Dagmar Geisler – Vorlesung 01/25
 Mit KI aus der Zwangslage
Mit KI aus der Zwangslage
„Täuschend echt“ von Charles Lewinsky – Literatur 01/25
 Doppelte Enthüllung
Doppelte Enthüllung
„Sputnik“ von Nikita Afanasjew – Literatur 12/24
 Eine wahre Liebesgeschichte
Eine wahre Liebesgeschichte
Thomas Strässles „Fluchtnovelle“ – Textwelten 12/24
 Befreiung durch Verwandlung
Befreiung durch Verwandlung
Laura Totenhagen im Stadtgarten – Musik 11/24
 Übergänge leicht gemacht
Übergänge leicht gemacht
„Tschüss und Kuss“ von Barbara Weber-Eisenmann – Vorlesung 11/24
 Die zärtlichen Geister
Die zärtlichen Geister
„Wir Gespenster“ von Michael Kumpfmüller – Textwelten 11/24
Aufwändige Abschlüsse
Comics, die spannend Geschichten zu Ende bringen – ComicKultur 02/25
Massenhaft Meisterschaft
Neue Comics von alten Hasen – ComicKultur 01/25
Gespräch über die Liebe
„In einem Zug“ von Daniel Glattauer – Textwelten 01/25
Kampf den weißen Blättern
Zwischen (Auto-)Biografie und Zeitgeschichte – ComicKultur 12/24
ABC-Architektur
„Buchstabenhausen“ von Jonas Tjäder und Maja Knochenhauer – Vorlesung 11/24
Comics über Comics
Originelle neue Graphic Novels – ComicKultur 11/24